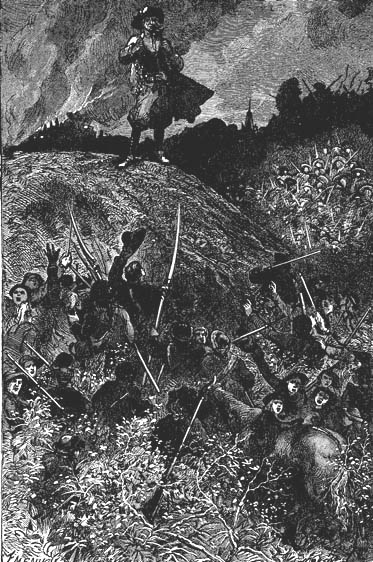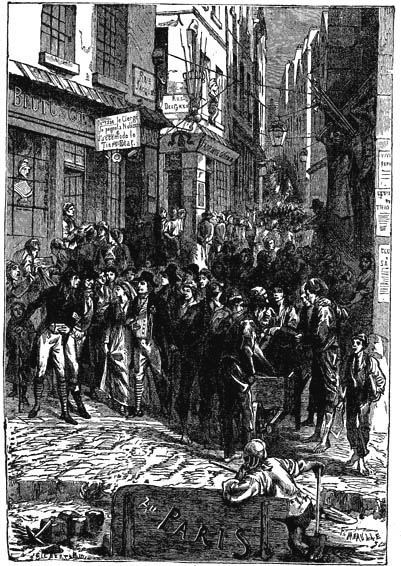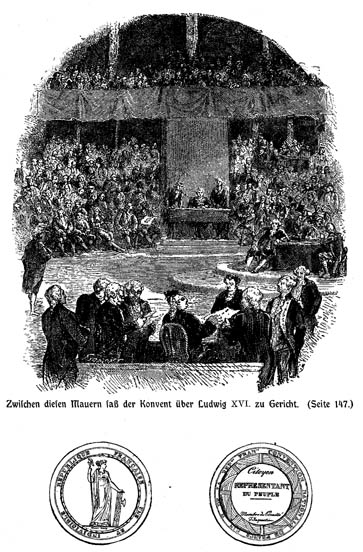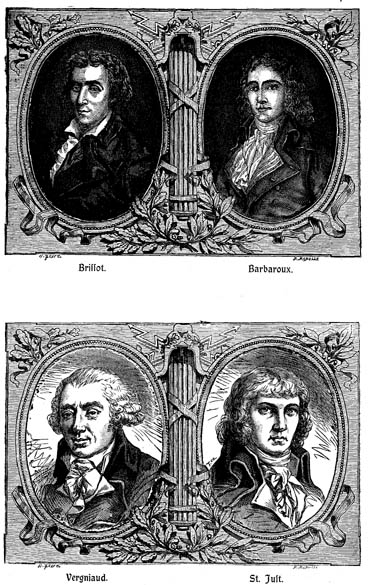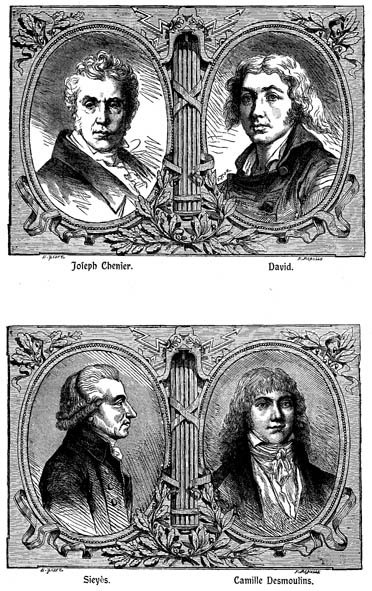Erstes Buch. Nacht und Mond.
Erstes Capitel. Die Hafenglocke.
Das heutige St. Sampson ist fast eine Stadt, das St. Sampson vor vierzig Jahren war fast ein Dorf.
Sobald der Frühling gekommen und die Wintertage zu Ende waren, machte man daselbst kurze Abende und begab sich mit Anbruch der Nacht zu Bette. St. Sampson, früher ein Pfarrdorf, in welchem zu Abend geläutet wurde, hatte die Gewohnheit beibehalten, seine Lichter zeitig auszulöschen, und mit dem Tage aufzustehen und zu Bette zu gehen. Diese alten normännischen Dörfer glichen darin den Hühnern.
Außerdem besteht St. Sampson’s Bevölkerung mit Ausnahme einiger reicher Bürgerfamilien, aus Steinbrechern und Zimmerleuten, da sein Hafen ein Ausbesserungshafen ist. Während des ganzen Tages fördert man Steine oder richtet Balken zu; hier herrscht die Picke, dort der Hammer. Beständiges Bearbeiten von Eichenholz und Granit. Am Abend fällt man vor Ermüdung am und schläft wie Blei. Auf harte Arbeit folgt ein fester Schlaf.
Eines Abends, im Anfang Mai, betrat Mess Lethierry, nachdem er während einiger Augenblicke dem Aufsteigen des Mondes über den Bäumen zugesehen und Deruchette’s Schritt, welche auf Kosten der Nacht allein in dem Garten der Bravées spazieren ging, belauscht hatte, sein Zimmer am Hafen und legte sich zu Bette. Douce und Grâce schliefen schon, und – Deruchette ausgenommen – das ganze Haus. Ueberhaupt hatte sich schon Alles in St. Sampson hingelegt. Alle Thüren und Thore waren geschlossen, Niemand ging mehr in den Straßen. Einige wenige Lichter brannten wie blinzelnde Augen, welche sich schließen wollen, hier und da hinter den Dachfenstern und verkündeten das Zubettegehen der Dienstboten. Schon hatte es neun Uhr von dem alten, mit Epheu bedeckten, römischen Thurme geschlagen, der mit der Kirche zu St. Breade auf Jersey die Eigenthümlichkeit theilt, daß er als Jahreszahl vier Eins trägt: 1111, was so viel, als Elfhundertelf heißen soll.
Die Volkstümlichkeit von Mess Lethierry zu St. Sampson hing mit seinem Erfolge zusammen. Sobald die Erfolge aufhörten, hatte sich die Verlassenheit eingestellt. Die hübschen Söhne der Familie vermieden Deruchette. Die Einsamkeit um die Bravées war jetzt so groß, daß man hier nicht einmal das kleine und doch so große Localereigniß erfahren hatte, welches an jenem Tage ganz St. Sampson in Aufregung versetzte. Der Vorsteher der Pfarre, der ehrenwerthe Joe Ebenezer Caudray, war reich geworden. Sein Onkel, Seine Herrlichkeit der Dekan von St. Asaph, war so eben zu London verstorben. Die Postschaluppe Cashmere, welche an demselben Morgen von England angekommen war und deren Flagge man auf der Rhede des St. Peterhafens wehen sah, hatte diese Nachricht mitgebracht; der Cashmere sollte am Mittag des folgenden Tages nach Southampton zurückkehren und, wie man erzählte, den ehrenwerthen Vorsteher mit sich nehmen, der ohne Verzug nach England zur officiellen Oeffnung des Testaments gerufen wurde, ganz abgesehen von den andern Drängnissen einer großen, in Empfang zu nehmenden Erbschaft. Den ganzen Tag hindurch hatte St. Sampson nur davon gesprochen. Der Cashmere, der ehrenwerthe Ebenezer, der Tod seines Onkels, sein Reichthum, seine Abreise und die Möglichkeit seiner Beförderung für die Zukunft bildeten den Gegenstand aller Gespräche. Nur ein einziges Haus war davon nicht unterrichtet und nahm nicht Theil; das der Bravées.
Mess Lethierry hatte sich völlig angekleidet auf seine Hängematte geworfen.
Seit dem Unglück der Durande warf er sich stets auf die Hängematte. Der Gefangene streckt sich auf seine Pritsche aus und Mess Lethierry war der Gefangene seines Kummers. Er legte sich hin; dann trat Ruhe ein, – Erholung, – ein Stillstand in seinen Gedanken. Schlief er? Nein. Wachte er? Nein. In Wahrheit befand er sich seit zwei und einem halben Monate – es waren zwei und ein halber Monat seit dem Untergange der Durande verflossen – in dem Zustande eines Nachtwandlers. Er hatte sich noch nicht wieder gefaßt und lebte in jener Verwirrung und Zerstreuung, welche nur die kennen, welche große Bekümmernisse durchgemacht haben. Seine Betrachtungen waren keine Gedanken, sein Schlaf keine Ruhe. Am Tage wachte er nicht und Nachts schlief er nicht; am Tage stand er nur, in der Nacht lag er nur, das war Alles. Lag er auf seiner Hängematte, so kam etwas Vergessen über ihn und er nannte das Schlaf. Einbildungen durchflogen ihn, nächtliche Wolken voll verwirrter Gesichter durchschwirrten sein Gehirn; der Kaiser Napoleon dictirte ihm seine Erinnerungen, es gab mehrere Deruchetten, sonderbare Vögel lebten auf den Bäumen, die Straßen zu Lons-le-Saulnier wurden zu Schlangen. Das Alpdrücken faßte ihn mit Verzweiflung. Er brachte seine Nächte mit Träumen und seine Tage mit Dämmern hin.
Bisweilen blieb er den ganzen Nachmittag hindurch unbeweglich an seinem Stubenfenster, welches – wie man sich erinnern wird – auf den Hafen hinausging, mit gesenktem Kopfe auf beide Fäuste gestützt, die Ellbogen gegen die Stirne gedrückt, der ganzen Welt den Rücken zukehrend, das Auge auf den alten Eisenring geheftet, welcher in die Mauer seines Hauses einige Fuß von seinem Fenster eingelassen war und an dem sonst die Durande befestigt wurde. Er betrachtete den Rost, welcher diesen Ring allmälig überzog.
Er war zur reinen Maschine herabgesunken.
Es befand sich ein Widerspruch in dieser Natur; er bildete ein Gemisch wie das Meer, aus welchem er war, ja, dessen Geschöpf man ihn eigentlich nennen konnte. Mess Lethierry betete nie.
So lange er glücklich war, existirte Gott, so zu sagen, mit Fleisch und Knochen für ihn; er sprach mit ihm, verpfändete ihm sein Wort und gab ihm fast von Zeit zu Zeit einen Händedruck. Aber in seinem Unglücke verschwand Gott gänzlich, wie immer, wenn man sich einen guten Gott geschaffen hat, der ein guter Mensch ist.
In diesem Seelenzustande gab es für ihn nur eine angenehme Erscheinung, Deruchette’s Lächeln. Außer diesem Lächeln war Alles für ihn schwarz.
Seit einiger Zeit war, ohne Zweifel in Folge des Verlustes der Durande, dessen Schlag sie mitgefühlt hatte, dies reizende Lächeln Deruchette’s seltener geworden. Sie schien in Gedanken versunken, ihr kindliches Spielen und Kosen hatte aufgehört. Morgens sah man sie nicht mehr bei Tagesanbruch einen Knix machen und der aufgehenden Sonne ein fröhliches »Guten Morgen!« zurufen! oder ein »Bitte, treten Sie näher.« Auf Augenblicke hatte sie sogar ein sehr ernstes Aussehen, eine traurige Erscheinung bei einem so sanften Wesen. Trotzdem gab sie sich alle Mühe, um Mess Lethierry anzulächeln und aufzuheitern, aber ihr Frohsinn minderte sich von Tag zu Tag und bedeckte sich mit Staub, wie die Flügel eines durchbohrten Schmetterlings. Außerdem schien sie sich, sei es aus Gram über den Kummer ihres Onkels, denn es giebt rückwirkende Schmerzen, sei es aus anderen Gründen, jetzt sehr zur Religion zu neigen. Zur Zeit des alten Pfarrers, Jaquemin Herode, ging sie, wie man weiß, kaum viermal jährlich in die Kirche; jetzt hingegen sehr oft. Sie fehlte bei keinem Gottesdienste, weder am Sonntage, noch am Donnerstage. Die frommen Seelen der Gemeinde sahen mit Befriedigung diese Aenderung. Denn es ist ein großes Glück für ein junges Mädchen, welches so vielen Gefahren von Seiten der Menschen ausgesetzt ist, wenn es sich zu Gott kehrt.
Die armen Eltern sind dann wenigstens vor Liebeleien gesichert.
Alle Abende, wenn es das Wetter erlaubt, ging sie eine oder zwei Stunden in dem Garten der Bravées spazieren und war dabei fast ebenso nachdenkend, wie Mess Lethierry, und immer allein. Sie ging zuletzt zu Bette; trotzdem beobachteten Douce und Grâce sie immer etwas mit dem Instincte der Wachsamkeit, welcher allen Dienstboten eigen ist; Spionieren macht das Dienen kurzweilig.
Bei dem umschleierten Zustande, in welchem sich sein Geist befand, entgingen diese kleinen Veränderungen in Deruchette’s Wesen Mess Lethierry. Außerdem war er nicht zum Hofmeister geboren. Er bemerkte selbst Deruchette’s Pünktlichkeit im Kirchengehen nicht.
Es war übrigens seit etwa einer Woche mit Mess Lethierry eine Veränderung vorgegangen; die Träumerei seiner ersten Verzweiflung war einer gewissen Zerstreuung gewichen; sein Geist war weniger traurig und weniger thatenlos; er war immer ernst, aber nicht mehr finster; ein gewisses Verständniß der Thatsachen und Ereignisse kam ihm wieder und er begann etwas davon zu spüren, was man den Rücktritt in die Wirklichkeit nennen könnte.
So hörte er am Tage in dem niedrigen Saale die Worte der Leute nicht, aber er verstand sie. Grâce kam eines Morgens ganz triumphirend zu Deruchette und theilte ihr mit, daß Mess Lethierry den Band einer Zeitung geöffnet habe.
Sich wieder für die Wirklichkeit interessiren, ist ein gutes Zeichen. Es verräth die Genesung.
Die Rückkehr zur Wirklichkeit hatte bei ihm folgende Veranlassung:
Eines Nachmittags gegen den fünfzehnten oder zwanzigsten April, hatte man an der Thür des niedrigen Saales der Bravées das zweimalige Klopfen des Briefträgers vernommen. Douce hatte geöffnet: es war in der That ein Brief.
Dieser Brief kam über’s Meer, war an Mess Lethierry adressirt und trug den Poststempel Lisboa.
Douce brachte ihn an Mess Lethierry, welcher sich in seinem Zimmer eingeschlossen hatte. Er nahm ihr den Brief ab und legte ihn mechanisch auf den Tisch, ohne ihn anzusehen. So blieb er eine gute Woche auf dem Tische ungeöffnet liegen.
Eines Morgens sagte endlich Douce zu ihm:
– Soll der Staub auf Ihrem Briefe abgewischt werden?
Lethierry schien zu erwachen und antwortete: Es ist gut.
Er öffnete den Brief und las Folgendes:
»Auf hoher See am zehnten März.
»Mess Lethierry, aus St.-Sampson.
»Sie werden mit Vergnügen von mir hören:
»Ich bin auf dem Tamaulipas; auf einer Reise, von welcher ich nicht zurückkehren werde. Unter der Schiffsmannschaft befindet sich der Matrose Ahier-Tostevin aus Guernesey, der wieder nach Hause fährt und Manches zu erzählen haben wird. Ich benutze die Begegnung mit dem Schiffe Hernan Cortez, welches nach Lissabon fährt, um Ihnen diesen Brief zukommen zu lassen.
»Wundern Sie Sich. Ich bin ein ehrlicher Mensch.
»Ebenso ehrlich, als Sieur Clubin.
»Ich muß glauben, daß Sie wissen, was sich ereignet hat; trotzdem ist es vielleicht nicht überflüssig, wenn ich es Ihnen mittheile.
»Also:
»Ich habe Ihnen Ihre Gelder wiedergegeben.
»Ich hatte mir von Ihnen auf etwas unedle Weise fünfzigtausend Francs geliehen. Bevor ich St. Malo verließ, übergab ich Ihrem Vertrauensmann, Sieur Clubin, für Sie drei Banknoten, jede zu tausend Pfund, was also fünfundsiebzigtausend Francs macht. Ohne Zweifel wird Ihnen diese Rückzahlung genügen.
»Sieur Clubin nahm Ihre Interessen und Ihr Geld mit großer Eile. Er schien mir sehr eifrig, weshalb ich Sie davon benachrichtige.
»Ihr anderer Vertrauensmann,
»Rantaine.«
» Nachschrift. Sieur Clubin hatte einen Revolver, deshalb habe ich keine Quittung.«
Beim Berühren eines Zitteraales oder einer geladenen Leydener Flasche fühlt man ungefähr ein Aehnliches, als was Mess Lethierry beim Lesen dieses Briefes empfand.
Dieses Couvert, dieses viermal zusammengelegte Blatt Papier, auf welches er zuerst so wenig geachtet hatte, mußte auf ihn eine tiefe Erschütterung ausüben.
Er erkannte die Schrift und die Unterschrift. Was die Sache anbetrifft, so verstand er zuerst Nichts.
Diese Erschütterung brachte so zu sagen, seinen Geist wieder auf die Beine.
Die Geschichte mit den fünfundsiebzigtausend Francs, welche Rantaine Clubin anvertraut hatte, war ein Räthsel und deshalb die nützlichste Seite der Erschütterung; denn sie zwang Lethierry’s Gehirn zum Arbeiten. Eine Vermuthung aufstellen, ist für den Verstand eine gesunde Beschäftigung. Vernunft und Logik werden von Neuem geweckt.
Seit einiger Zeit beschäftigte sich die öffentliche Meinung zu Guernesey wieder mit der Beurtheilung Clubin’s, jenes ehrbaren Mannes, welcher so viele Jahre hindurch und so allgemein in hoher Achtung gestanden hatte. Man fragte sich, begann zu zweifeln wettete für und gegen und stellte eigenthümliche Ansichten auf. Man begann sich über Clubin aufzuklären, das Für und Wider seines Charakters hervorzuheben.
Eine gerichtliche Erkundigung, was aus dem Küstenwächter 619 geworden sei, fand zu St. Malo statt. Das scharfe Auge des Gesetzes hatte einen falschen Weg eingeschlagen, was ihm oft passirt. Es ging nämlich von der Ansicht aus, daß der Küstenwächter von Zuela angeworben und auf dem Tamaulipas nach Chili eingeschifft sei. Diese geistreiche Vermuthung hatte starke Irrthümer nach sich gezogen und die Kurzsichtigkeit der Gerechtigkeit Rantaine nicht einmal bemerkt, aber dafür hatten die Untersuchungsrichter unterwegs andere Fährten aufgefunden und die dunkle Geschichte dadurch noch verwickelter gemacht, indem auch Clubin in das Räthsel mit hineingezogen und eine Gleichzeitigkeit, ja selbst die Möglichkeit in einer Beziehung zwischen der Abfahrt des Tamaulipas und des Verlustes der Durande festgestellt wurde. Im Gasthause am Dinan-Thore, wo Clubin unbekannt zu sein glaubte, hatte man ihn erkannt; der Gastwirth hatte geplaudert: Clubin habe eine Flasche Branntwein gekauft. Für wen? Der Waffenschmied in der Straße St.-Vincent erzählte, Clubin habe bei ihm einen Revolver gekauft. Gegen wen? Clubin hatte keine Erklärung abgegeben. Der Capitain Gertrais-Gaboureau hatte gesprochen. Clubin hatte abfahren wollen, obwohl gewarnt und wissend, daß er in den Nebel ging. Die Bemannung der Durande hatte gesprochen. Die Beladung war mangelhaft und das Takelwerk schlecht, leicht zu verstehende Nachlässigkeiten, wenn der Capitain das Schiff zu Grunde richten will. Die Passagiere aus Guernesey hatten erzählt, Clubin habe auf den Hanois zu stranden geglaubt, die Leute aus Torteval wußten, daß Clubin dort einige Tage vor dem Verlust der Durande angekommen und nach Plainmont, in der Nähe der Hanois, gegangen sei. Er trug ein Felleisen. Er war damit fortgegangen, aber ohne dasselbe zurückgekommen. Die Grünlinge hatten gesprochen und ihre Geschichte schien mit Clubin’s Verschwinden zusammenzupassen, sobald man die Rückkehrenden für Pascher halten konnte. Endlich hatte auch das Geisterhaus zu Plainmont selbst geplaudert: entschiedene Leute waren hineingestiegen, und was hatten sie daselbst gefunden? Gerade Clubin’s Felleisen. Das Zollamt von Torteval hatte es mit Beschlag belegen und öffnen lassen. Es enthielt Mundvorrath, ein Fernrohr, einen Chronometer, Kleider und Wäsche mit Clubin’s Anfangsbuchstaben. Alles dies baute sich in den Gemüthern der Bewohner von St. Malo und Guernesey zusammen auf und bildete sich zu einem vollen Betruge aus. Man brachte verwirrte Angaben zusammen; man constatirte mit einer eigenthümlichen Verachtung alle Angaben; sie bildeten einen zusammenhängenden Rahmen. Der Zufall des Nebels, die verdächtige Nachlässigkeit in der Auftakelung, die Flasche Branntwein, der trunkene Steuermann, der Capitain an Stelle des Steuermanns und der zum Wenigsten sehr ungeschickte Barrenschlag, der Heldenmuth, auf der Brandung zu bleiben, wurde zur Gaunerei. Clubin hatte sich übrigens in der Klippe getäuscht. Sobald die Absicht eines Betruges festgestellt war, verstand man auch die Wahl der Hanois, da die Küste leicht durch Schwimmen zu gewinnen war, und sie boten Gelegenheit zum Aufenthalt im Geisterhause, um eine Gelegenheit zur Flucht erwarten zu können. Das Felleisen vollendete den Beweis. Durch welches Band dies Abenteuer aber mit dem andern, dem des Küstenwächters, zusammenhing, begriff man nicht. Man ahnte einen Zusammenhang; weiter nichts. Man vermuthete, seitens dieses Menschen, dem Küstenwächter Nummer 619, ein ganzes Trauerspiel, in welchem Clubin vielleicht nicht mitspielte; man bemerkte ihn aber hinter den Coulissen.
Alles klärte sich nicht durch den Betrug auf. Wozu diente der Revolver? Wahrscheinlich gehörte er zu der andern Geschichte.
Das Gefühl des Volkes ist fein und gerecht und stellt wunderbar richtig die Wahrheit aus einzelnen Theilen und Stücken wieder her; nur über die Ursachen des wahrscheinlichen Betruges herrschte tiefe Ungewißheit.
Alles hielt und paßte zusammen; aber der Grund fehlte.
Man giebt kein Schiff aus reinem Vergnügen auf und unterzieht sich nicht allen Gefahren des Nebels, der Klippe, des Schwimmens und der Flucht ohne Interesse. Welches Interesse hatte aber Clubin haben können?
Man sah seine That, aber nicht seinen Beweggrund.
Deshalb zweifelten Viele. Wo kein Grund ist, scheint auch keine That zu sein.
Die Lücke war groß, aber Rantaine’s Brief füllte sie aus; denn er gab Clubin’s Beweggrund an: Clubin wollte fünfundsiebzigtausend Francs stehlen.
Rantaine war der deus ex machina, der aus den Wolken mit der Leuchte in der Hand herabsteigt.
Sein Brief gab die völlige Aufklärung.
Er erklärte Alles und gab außerdem noch einen Zeugen an, Ahier-Tostevin.
Er entschied auch über die Benutzung des Revolvers. Ohne Zweifel war Rantaine vollkommen unterrichtet, denn sein Brief berührte Alles sehr genau.
Keine Möglichkeit gab es, um Clubin’s Schlechtigkeit zu verringern. Er hatte den Schiffbruch vorher ausgesonnen, der Beweis dafür war das in dem Geisterhause gefundene Felleisen. Sollte man ihn wirklich für unschuldig und den Schiffbruch für zufällig halten, hätte er dann nicht im letzten Augenblicke, als er entschlossen war, sich aus der Klippe zu opfern, die fünfundsiebzigtausend Francs für Mess Lethierry den Leuten übergeben müssen, welche sich in der Schaluppe retteten? Die überzeugende Wahrheit brach hervor. Was war jetzt aus Clubin geworden? Wahrscheinlich war er das Opfer seines Irrthums geworden und ohne Zweifel auf der Douvre-Klippe untergegangen.
Das Aufbauen dieser, wie man sieht, der Wahrheit sehr nahekommenden Vermuthungen beschäftigte Mess Lethierry mehrere Tage hindurch. Rantaine’s Brief erwies ihm den Dienst, ihn zum Nachdenken zu zwingen. Zuerst durchzitterte ihn Ueberraschung, dann machte er die Anstrengung, sich an’s Ueberlegen zu geben und hierauf die noch schwierigere, Erkundigungen einzuziehen. Er mußte Unterhaltungen aufnehmen, ja sie selbst suchen. Nach Verlauf von acht Tagen war er bis auf einen gewissen Punkt wieder praktisch geworden, sein Geist hatte sich wieder zusammengerafft, und war fast geheilt, jedenfalls aus seinem verwirrten Zustande herausgetreten.
Rantaine’s Brief gab zwar zu, daß Mess Lethierry einige Hoffnung auf Wiedererstattung von dieser Seite her hätte unterhalten können, zerstörte aber gleichzeitig seine letzte Zuversicht.
Sie fügte zu dem Unglück der Durande diesen neuen Schiffbruch der fünfundsiebzigtausend Francs, brachte ihn für einen Augenblick wieder in den Besitz dieses Geldes, um ihn dessen ganzen Verlust desto härter fühlen zu lassen und zeigte ihm den vollen Abgrund seines Unglücks.
Er begann – was er seit zwei Monaten nicht gethan hatte – sich wieder damit zu beschäftigen, was mit seinem Hause, und was mit ihm werden, was er anfangen sollte. Kleinliche, tausendspitzige Sorgen quälten ihn, ein Zustand, fast ärger als der der Verzweiflung. Das geschehene Unglück läßt sich tragen, nicht das, was man hereinbrechen sieht. Voll drückt es nieder, getheilt martert es. Untergehen ist nichts, höchstens großes Feuer, aber Verarmen ist ein kleines Feuer.
An dem Abend, von dem wir sprachen, einem der ersten im Mai, ließ Lethierry beim Mondenschein Deruchette in dem Garten umherwandern und legte sich, trauriger als je, zu Bette.
So manche unangenehme und ungefällige Kleinigkeiten, die Zugaben zum Verluste des Vermögens, alle diese Sorgen dritter Ordnung, durchflogen seinen Geist. Was sollte er thun? Was sollte aus ihm werden? Welche Opfer konnte er Deruchette auferlegen? Wen sollte er fortschicken, Douce oder Grâce? Sollte er die Bravées verkaufen? Würde er nicht die Insel verlassen müssen? Da nichts sein, wo man Alles gewesen ist, ist in der That nicht zu ertragen.
Und war das Alles?! Dazu kamen die Erinnerungen an die Ueberfahrten, welche Frankreich mit den Inseln verbanden, an das Fortgehen Dienstags und die Rückkunft Freitags, an die Menge auf dem Quai, an jene mächtigen Befrachtungen, jenen Fleiß, jenes Aufblühen, jene gerade und stolze Schifffahrt, jene Maschine, auf welche der Mensch seinen Willen überträgt, jenen allmächtigen Dampfkessel, jenen Rauch, jene Wirklichkeit!
Diese ganze Fülle des Bedauerns marterte Lethierry. Niemals vielleicht hatte er seinen Verlust bitterer empfunden. Eine gewisse Betäubung folgt solchen scharfen Anfällen. Unter dieser drückenden Traurigkeit schlummerte er ein.
Er blieb ungefähr zwei Stunden mit geschlossenen Augen, etwas schlafend, viel träumend und fieberhaft. Solche Erschlaffung verdeckt eine dunkle, sehr anstrengende Arbeit des Gehirns. Gegen Mitternacht, etwas früher oder später, schüttelte er diesen Schlaf ab. Er wachte auf, öffnete die Augen und sah durch das seiner Hängematte gegenüberliegende Fenster etwas Außergewöhnliches.
Eine Gestalt war vor seinem Fenster. Eine unerhörte Gestalt. Der Schlot eines Dampfers.
Mess Lethierry setzte sich mit einem Ruck aufrecht. Die Hängematte schwankte wie durch das Rütteln eines Sturmes. Lethierry blickte hinaus. In dem Fenster lag eine geisterhafte Erscheinung. Der hell vom Mond beschienene Hafen zeichnete sich auf den Gläsern ab und auf dieser Helle schnitt sich dicht beim Hause gerade, rund und schwarz ein prächtiges Schattenbild aus.
Die Röhre einer Maschine war da.
Lethierry sprang aus der Hängematte, lief an das Fenster, schob den Riegel zurück, bog sich nach außen und erkannte den Gegenstand.
Der Rauchfang der Durande lag vor ihm, sie lag auf ihrem alten Platze.
Vier Ketten hielten den Rauchfang an Bord eines Schiffes fest, in welchem man eine Masse mit undeutlichen Umrissen erkannte.
Lethierry bebte zurück, kehrte dem Fenster den Rücken zu und fiel sitzend auf die Hängematte zurück.
Er drehte sich um und sah die Erscheinung wieder.
Einen Augenblick später war er, eine Laterne in der Hand, mit Blitzesschnelle auf dem Quai.
An einem alten Ankerringe der Durande war eine Barke befestigt, welche etwas nach hinten zu einen massiven Block trug, aus dem der Schornstein gerade vor dem Fenster der Bravées in die Höhe stieg. Der Vordertheil der Barke verlängerte sich außen über die Mauerecke des Hauses hinaus, mit dem Quai in gleicher Richtung.
Niemand war in der Barke.
Diese Barke hatte eine so eigenthümliche Form, daß ganz Guernesey sie hätte beschreiben können. Es war der Rumpf.
Lethierry sprang hinein und eilte auf die Masse zu, welche er jenseits des Wassers sah. Es war die Maschine.
Sie war da, ganz, vollständig, unversehrt, fest auf ihrem eisernen Boden ruhend; der Dampfkessel hatte alle seine Scheidewände; der Radbaum war neben ihm befestigt; die Pumpe an ihrem Platze; nichts fehlte.
Lethierry untersuchte die Maschine.
Die Laterne und der Mondschein halfen ihm dabei.
Er untersuchte den Mechanismus.
Er sah die beiden Kasten, welche an der Seite waren, betrachtete den Radbaum, ging in die Kabine, welche leer war, dann zu der Maschine zurück, berührte sie, steckte seinen Kopf in den Kessel und kniete nieder, um hineinsehen zu können.
Er hielt seine Laterne in die Feuerung, deren Licht den ganzen Mechanismus erhellte und fast die Täuschung einer geheizten Maschine hervorrief.
Dann begann er zu lachen und sich umdrehend, das Auge auf die Maschine gefesselt und die Arme gegen den Schlot ausgestreckt, rief er: Zur Hülfe!
Die Hafenglocke befand sich einige Schritte von ihm auf dem Quai, er lief hin, erfaßte die Kette und begann heftig zu läuten.
————
Zweites Capitel. Noch einmal die Hafenglocke.
Gilliatt war in der That nach einer abenteuerlosen, aber bei der schweren Ladung der Barke etwas langsamen Fahrt, nach Anbruch der Nacht, näher an zehn als an neun Uhr, in St. Sampson angekommen.
Gilliatt hatte die Stunde berechnet, es war zur Zeit der halben Fluth, so daß man bei genügendem Mondschein und Wasser in den Hafen gelangen konnte.
Der kleine Hafen war in vollständiger Ruhe. Einige Schiffe lagen dort vor Anker, die Geytaue auf den Raaen, die Mastseile angelegt und ohne Leuchten. Im Hintergrunde bemerkte man einige Barken, welche ausgebessert werden sollten, trocken auf den Werften liegend.
Sobald Gilliatt durch die Brandung gefahren war, hatte er den Hafen und den Quai untersucht. Nirgends brannte Licht, weder in den Bravées noch anderswo. Kein Mensch ließ sich mehr blicken, vielleicht mit Ausnahme eines Einzigen, der in das Pfarrhaus hineinging oder es verließ. Zudem war es noch nicht sicher, ob es überhaupt eine Person war, da die Nacht Alles, was sie malt, vertuscht und der Mondschein nie etwas Anderes als Unentschiedenes zeigt. Die Entfernung vermehrte noch die Dunkelheit. Außerdem lag das Pfarrhaus auf der andern Seite des Hafens, an einer Stelle, wo sich heute ein offener Raum befindet.
Gilliatt war schweigend an den Bravées gelandet und hatte die Barke an dem Ringe der Durande unter Mess Lethierry’s Fenster befestigt.
Dann war er über Bord auf das Land gesprungen.
Nachdem er die Barke am Quai angelegt hatte, ging er um das Haus, hierauf eine Straße entlang, dann noch eine, betrachtete nicht einmal den Seitenweg, welcher nach Bû de la Rue führte, und blieb nach einigen Minuten in der Mauerecke stehen, wo sich wilde Malven mit rosenfarbnen Blumen im Juni, Stechpalmen, Epheu und Nesseln finden. Von dort hatte er, unter Brombeeren verborgen und auf einem Steine sitzend, oft in den Sommertagen lange Stunden und ganze Nächte hindurch über diese Mauer, welche so niedrig war, daß man sie zu übersteigen versuchen konnte, den Garten der Bravées und durch die Baumäste zwei Fenster eines Zimmers in dem Hause betrachtet. Er fand seinen Stein wieder, seine Brombeeren, die immer gleich niedrige Mauer, den noch immer dunkeln Winkel, und wie ein Raubthier, welches in seinen Schlupfwinkel zurückkehrt, verschwand er mehr schleichend als gehend darin. Da er erst einmal da saß, machte er keine Bewegung mehr. Er betrachtete nur; er sah den Garten, die Gänge, die Gebüsche, die Blumenbeete, das Haus und die beiden Zimmerfenster wieder. Der Mond zeigte ihm dieses Bild. – Es ist schrecklich, daß man athmen muß. Er that Alles, was in seinen Kräften stand, um sogar das Athmen zu verhindern.
Es war ihm, als wenn er ein Geisterparadies sähe. Er hatte Furcht, daß Alles davonfliegen könnte. Fast unmöglich war es, daß diese Dinge vor seinen Augen wahr sein sollten, und wenn sie dort sich befanden, so würden sie auch plötzlich wieder verschwinden, wie es bei allen göttlichen Dingen der Fall ist. Ein Hauch und Alles würde verfliegen. Gilliatt zitterte davor.
Ganz nahe vor ihm, an dem Ende eines Baumganges befand sich in dem Garten eine grünangestrichene Holzbank. Man erinnert sich dieser Bank.
Gilliatt betrachtete die beiden Fenster und dachte daran, daß vielleicht Jemand hinter ihnen schliefe. Er war auf diesen Fleck gebannt; er hätte lieber sterben, als fortgehen mögen. Er dachte an das Athmen, welches eine Brust schwellte. Sie, dieses Wunder, dieses Licht in der Dunkelheit, dieses Wesen, das ganz seinen Geist durchwogte; sie war da! Er dachte an sie, die ihm so nahe und doch jetzt unerreichbar war. Seine Seele war im Himmel.
Der Himmel ist ebenso gut für das Herz eines armen Menschen, wie Gilliatt, als für das eines Millionärs geschaffen. Auf einer gewissen Stufe der Leidenschaft ist jeder Mensch dieser Verblendung unterworfen. Ist es eine rauhe und ursprüngliche Seele, so ist noch mehr Grund dazu vorhanden. Dann tritt noch die Wildheit zu dem Traume.
Das Entzücken ist eine zu große Fülle, welche wie jede andere überfluthet. Diese Fenster sehen, war für Gilliatt fast zu viel.
Plötzlich sah er sie selbst.
Aus den Zweigen eines durch den Frühling schon starkbelaubten Gebüsches trat mit einer unbeschreibbaren, geisterhaften und himmlischen Ruhe eine Gestalt, ein Kleid, ein göttliches Gesicht, fast eine Helle unter dem Monde hervor.
Gilliatt fühlte sich schwach werden, es war Deruchette.
Deruchette näherte sich, blieb stehen, that einige Schritte, um sich zu entfernen, blieb wieder stehen, kam dann zurück und setzte sich auf die Holzbank. Der Mond schien durch die Bäume, einige Wolken irrten zwischen den bleichen Sternen, die Stadt schlief. Deruchette beugte den Kopf mit den gedankenvollen Augen, welche etwas aufmerksam betrachteten; man sah ihr Gesicht von der Seite, der Kopf war fast unbedeckt, da die Mütze sich gelöst hatte und auf ihrem zarten Nacken die wogenden Haare sehen ließ; sie rollte mechanisch ein Haubenband um einen Finger, Halbschatten umgab ihre Marmorhände, ihr Kleid trug eine von jenen Farben, welche die Nacht weiß färbt; die Bäume bewegten sich, als wenn sie den Zauber, welcher sie umgab, verständen; man sah die Spitze eines ihrer Füße, ihre gesenkten Wimpern zeigten jenes unbestimmte Zucken, welches eine zurückgetretene Thräne oder einen zurückgedrängten Gedanken verräth; ihre Arme entfalteten die entzückende Unbestimmtheit, welche keinen Stützpunkt zu finden weiß; etwas Schwankendes mischte sich in ihre ganze Haltung; es war mehr ein Schein, als ein Licht, mehr eine Grazie, als eine Göttin; die Falten unten an ihrem Unterrocke waren ausgewählt schön, ihr anbetungswürdiges Gesicht sann jungfräulich nach. Sie befand sich ganz in seiner Nähe. Gilliatt hörte sie sogar athmen.
Tief im Verborgnen sang eine Nachtigall. Das Streichen des Windes durch die Zweige setzte die unbeschreibbare nächtliche Stille in Bewegung. Deruchette, schön und heilig, erschien in dieser Dämmerung wie die Blume in ihren Strahlen und Düften; dieser unendliche und weitverbreitete Reiz schwebte geheimnißvoll zu ihr und verdichtete sich bei ihr, so daß er sie ganz einnahm. Sie erschien als die Blumenseele dieses ganzen Schattens.
Dieser ganze, Deruchette umwogende Schatten drückte auf Gilliatt. Er war überwältigt. Was er empfand, läßt sich nicht durch Worte wiedergeben; die Bewegung ist immer neu und das Wort sagt immer dasselbe; daher die Unmöglichkeit, die Bewegung zu schildern. Es ist das Uebermaß des Zaubers, – Deruchette sehen, sie selbst, ihr Kleid, ihre Haube, ihr Band, welches sie um den Finger rollte, kann man sich so etwas vorstellen? War es möglich, neben ihr zu sein? Was sollte er jetzt thun? Dieser Zauber, sie zu sehen, betäubte ihn. Sie war da und er war hier! Seine Gedanken, geblendet und festgewurzelt, blieben auf diesem Geschöpfe, wie auf einem Karfunkel haften. Er betrachtete diesen Nacken und diese Haare; aber er sagte sich nicht einmal in Gedanken, daß er binnen Kurzem, morgen vielleicht das Recht haben würde, dieses Band zu lösen, diese Haube abzunehmen. So weit zu träumen, dieses Uebermaß von Kühnheit hätte er nicht einen Augenblick begriffen. Er glaubte zu sterben.
Aufstehen, die Mauer übersteigen, sich nähern, sagen »ich bin es«, mit Deruchette sprechen, dieser Gedanke kam ihm nicht. Und wäre er ihm gekommen, so hätte er sich geflüchtet. Wenn etwas einem Gedanken Aehnliches seinen Kopf durchzitterte, so war es das, daß Deruchette da war. Weiter verlangte er jetzt nichts; die Ewigkeit hätte beginnen können.
Ein Geräusch störte sie alle Beide; sie in ihrer Träumerei, ihn in seinem Entzücken.
Es ging Jemand im Garten. Wegen der Bäume konnte man nicht sehen, wer es war. Es war der Schritt eines Mannes.
Deruchette hob die Augen in die Höhe.
Die Schritte näherten sich und hörten dann auf. Der Gehende war so eben stehen geblieben. Er mußte ganz nahe sein. Der Pfad, in welchem die Bank war, verlor sich zwischen zwei dichten Gebüschen. Dort war dieser Mensch, an dieser Stelle, einige Schritte von der Bank.
Der Zufall hatte die dichtbelaubten Zweige derartig vertheilt, daß Deruchette, nicht aber Gilliatt ihn sehen konnte.
Der Mond zeichnete von dem Gebüsch bis zur Bank auf der Erde einen Schatten.
Gilliatt sah diesen Schatten.
Er betrachtete Deruchette.
Sie war ganz blaß. Ihr halbgeöffneter Mund hauchte einen Schrei der Ueberraschung. Sie hatte sich halb von der Bank erhoben und war wieder halb darauf zurückgefallen; in ihrer Stellung lag etwas von Flucht und von Bezauberung. Ihr Staunen war ein Entzücken voller Furcht. Auf ihren Lippen hatte sie fast ein strahlendes Lächeln und in ihren Augen leuchtende Thränen. Sie schien durch die Ankunft wie verklärt und nicht mehr der Erde angehörig. Ein Engel spiegelte sich in ihrem Blicke wieder.
Das Wesen, welches für Gilliatt nur ein Schatten war, sprach. Eine Stimme, sanft wie die eines Weibes und doch eine Mannesstimme, drang aus dem Gebüsch hervor. Gilliatt hörte folgende Worte:
– Mein Fräulein, ich sehe Sie jetzt jeden Sonntag und jeden Donnerstag; man sagte mir, daß Sie sonst nicht so oft kamen. – Man hat diese Bemerkung gemacht, ich bitte deshalb um Verzeihung. Ich habe nie zu Ihnen gesprochen, ich durfte nicht; heute spreche ich zu Ihnen, es ist meine Pflicht. Ich muß mich zuerst an Sie wenden. Der Cashmere fährt morgen ab; deshalb bin ich gekommen. Sie spazieren alle Abende in Ihrem Garten. Es wäre schlecht von mir, Ihre Gewohnheiten zu beobachten, wenn ich nicht eine bestimmte Absicht dabei hätte. Mein Fräulein, Sie sind arm; seit heute früh bin ich reich. Wollen Sie mich zu Ihrem Gatten?
Deruchette faltete ihre Hände, wie eine Bittende, und betrachtete den, der zu ihr sprach, stumm, mit festem Auge, zitternd vom Kopfe bis zu den Füßen.
Die Stimme fuhr fort:
– Ich liebe Sie. Gott hat das Herz des Menschen nicht dazu gemacht, daß es schweige. Es giebt für mich auf der Erde nur Ein Weib, das sind Sie. Ich denke an Sie, wie an eine Verheißung. Mein Glauben ist an Gott und meine Hoffnung in Ihnen. Sie sind mein Leben und schon mein Himmel.
– Mein Herr, antwortete Deruchette, es ist Niemand im Hause, um Ihnen zu antworten.
Die Stimme erhob sich vom Neuem:
– Ich habe diesen süßen Traum gehabt. Gott verbietet keine Träume. Sie machen auf mich den Eindruck einer Glorie. Ich liebe Sie leidenschaftlich. Die heilige Unschuld sind Sie. Ich weiß, daß jetzt die Stunde ist, in welcher man schläft; aber ich hatte nicht die Wahl eines andern Augenblicks. Erinnern Sie sich der Stelle in der heiligen Schrift, welche uns einmal vorgelesen wurde. Ich habe seitdem immer daran gedacht. Ich habe sie oft wiedergelesen. Der ehrwürdige Herode sagte zu mir: Du mußt eine reiche Frau haben. Ich antwortete ihm: Nein, ich muß eine arme Frau haben. Mein Fräulein, ich spreche zu Ihnen, ohne mich zu nähern, ich werde sogar zurücktreten, wenn Sie nicht wollen, daß mein Schatten Ihre Füße berührt. Sie sind die Herrscherin; Sie werden zu mir kommen, wenn Sie wollen. Ich liebe und warte. Sie sind die lebende Gestalt des Segens.
– Mein Herr, stammelte Deruchette, ich wußte nicht, daß man mich Sonntags und Donnerstags bemerkte.
Die Stimme fuhr fort:
– Man vermag nichts gegen das Ueberirdische. Das ganze Gesetz ist Liebe. Die Heirath ist Kanaan. Sie sind die verheißene Schönheit. O höchste Anmuth, ich grüße Sie.
Deruchette antwortete:
– Ich glaubte nichts Schlechteres zu thun, als alle Andern, welche ihre Pflicht thun.
Die Stimme sprach weiter:
– Gott hat seinen Willen in die Blumen, die Morgenröthe, den Frühling gelegt und er will, daß man liebt. Sie sind schön in dieser heiligen Dunkelheit der Nacht. Dieser Garten ist von Ihnen gepflanzt, und in seinen Düften ruht etwas von Ihrem Odem. Mein Fräulein, die Begegnungen der Seele hängen nicht von sich ab. Es ist nicht unser Fehler. Sie waren da, ich war da, weiter nichts. Ich habe nichts gethan, als gefühlt, daß ich Sie liebe. Bisweilen haben sich meine Augen zu Ihnen erhoben. Ich habe Unrecht gethan, aber was sollte ich thun? Indem ich Sie ansah, kam Alles. Man kann es nicht verhindern. Es giebt einen geheimnißvollen Willen, der über uns ist. Der erste Tempel ist das Herz. Ihre Seele in meinem Hause haben, nach diesem irdischen Paradiese sehne ich mich; stimmen Sie ein? So lange ich arm war, habe ich nichts gesagt. Ich weiß Ihr Alter. Sie sind einundzwanzig, ich sechsundzwanzig Jahre. Ich reise morgen ab, wenn Sie mich zurückweisen, für immer. Seien Sie meine Verlobte, wollen Sie? Meine Augen haben schon mehr als einmal wider meinen Willen den Ihrigen diese Frage vorgelegt. Ich liebe Sie, antworten Sie mir. Ich werde mit Ihrem Onkel sprechen, sobald er mich empfangen kann. Zuerst aber wende ich mich an Sie. Oder könnten Sie mich nicht lieben?
Deruchette neigte den Kopf und murmelte:
– O! Ich bete ihn an!
Sie sagte das so leise, daß nur Gilliatt es hörte.
Sie stand fortwährend mit gebeugtem Haupte; als wenn das Gesicht im Schatten auch den Gedanken beschatten solle.
Eine Pause entstand. Die Blätter an den Bäumen bewegten sich nicht. Es war ein ernster und stiller Augenblick, in welchem der Schlummer der Dinge sich mit dem Schlummer der Wesen vereinte und die Nacht den Herzschlag der Natur zu hören schien. Aus dieser Ruhe erhob sich, wie eine Harmonie, welche das Schweigen vervollständigt, das unendliche Rollen des Meeres.
Die Stimme begann wieder:
– Mein Fräulein!
Deruchette zitterte.
Die Stimme fuhr fort:
– Ach! Ich warte.
– Worauf warten Sie?
– Auf Ihre Antwort.
– Gott hat die Antwort gehört, sagte Deruchette.
Dann wurde die Stimme beinahe feierlich und zugleich sanfter, als je. Folgende Worte drangen aus dem Dickichte, wie aus einem feurigen Busche hervor:
– Du bist meine Verlobte. Erhebe Dich und komme. Möge der blaue Sternenhimmel dieser unserer Verlobung beiwohnen und möge sich unser erster Kuß mit dem Firmamente vermischen!
Deruchette erhob sich und blieb einen Augenblick unbeweglich, den Blick vor sich geheftet; ohne Zweifel auf einen andern Blick wartend. Dann, mit langsamen Schritten, den Kopf erhoben, die Arme hängend und die Finger ausgestreckt, als wenn man auf einer unbekannten Stütze vorwärts schreitet, ging sie auf das Gebüsch zu und verschwand daselbst.
Einen Augenblick später befanden sich auf dem Sande anstatt eines Schattens zwei; sie gingen in einander über und Gilliatt bemerkte zu seinen Füßen die Umarmung dieser beiden Schatten.
Die Zeit enteilt von uns, gleich einer Sanduhr, ohne daß wir diese Flucht fühlen; namentlich in gewissen Augenblicken höchster Seligkeit. Dies Paar einerseits, welches diesen Zeugen nicht vermuthete und ihn nicht sah; dieser Zeuge andererseits, welcher dies Paar nicht sah, aber seine Gegenwart wußte, – wie viele Minuten blieben sie so, in dieser geheimnißvollen Spannung? Unmöglich ist es, dies zu sagen. Plötzlich erscholl ein entfernter Lärm, eine Stimme rief: Zur Hülfe! Die Hafenglocke ertönte. Dieses Geräusch vernahm wahrscheinlich das trunkene und himmlische Glück nicht.
Die Glocke fuhr fort zu läuten. Hätte Jemand Gilliatt in dem Mauerwinkel gesucht, so hätte er ihn nicht gefunden.