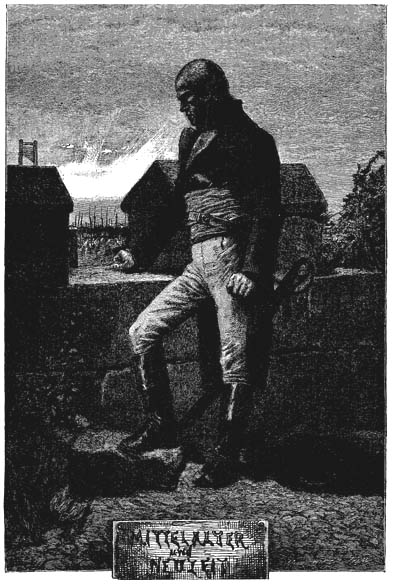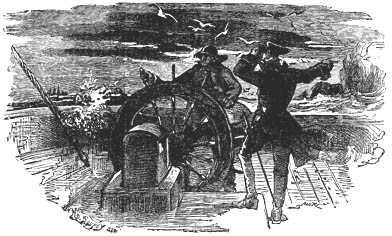Sechstes Buch
Nach dem Sieg der härteste Kampf
I.
Lantenac gefangen
Der Marquis war wirklich in die Gruft zurückgekehrt. Man führte ihn ab. Sofort wurde, unter Cimourdain’s strenger Aufsicht das ebenerdige in den Stein gehauene Verließ von La Tourgue geöffnet, eine Lampe, ein Krug Wasser, ein Kommislaib und ein Strohbündel hineingeschafft, und bevor noch eine Viertelstunde verflossen war, seitdem die Hand des Priesters den Marquis berührt hatte, schloß sich bereits hinter Lantenac die Thür seines Kerkers. Gleich darauf – es schlug in der Ferne auf dem Kirchthurm von Parigné gerade elf – begab sich Cimourdain zu Gauvain und sagte zu ihm: Ich werde ein Kriegsgericht einsetzen, ohne jedoch Dich beizuziehen. Du bist ein Gauvain und Lantenac ist ein Gauvain. Ihr seid zu nahe verwandt, als daß Du sein Richter sein könntest, und ich tadele es, daß Egalité über Capet mit abgeurtheilt hat. Das Kriegsgericht wird aus drei Richtern bestehen, einem Offizier, dem Hauptmann Guéchamp, einem Unteroffizier, dem Sergeanten Radoub, und mir, dem Präsidenten. Mit Allem, was von jetzt ab geschehen soll, hast Du Dich nicht zu befassen. Wir halten uns an den Beschluß des Konvents und werden ganz einfach die Identität des vormaligen Marquis von Lantenac feststellen. Morgen die Gerichtssitzung, übermorgen die Guillotine. Die Vendée ist todt.
Gauvain machte nicht die geringste Einwendung, und Cimourdain, von dieser seiner endgültigen Aufgabe völlig in Anspruch genommen, verließ ihn, denn es blieben noch Stunden zu bestimmen und Lokalitäten zu wählen. Wie Lequinio zu Granville, Tallien zu Bordeaux, Châlier zu Lyon, Saint-Just zu Straßburg, pflegte er bei den Hinrichtungen zugegen zu sein; diese Gewohnheit des Richters, dem Henker zuzuschauen, galt für ein gutes Beispiel und war von den dreiundneunziger Schreckensmännern den französischen Parlamenten und der spanischen Inquisition entlehnt worden.
Nicht minder in Anspruch genommen war auch Gauvain.
Vom Wald her blies ein rauher Wind. Gauvain überließ es Guéchamp, die nöthigen Befehle zu ertheilen, ging in sein Zelt am Waldsaum, auf dem Rasenplatz vor La Tourgue, und hüllte sich in seinen Mantel. Dieser Mantel war mit einer Kapuze versehen und mit jener einfachen Borte besetzt, in der die prunklos republikanische Auszeichnung der Korpskommandanten bestand. Dann wandelte er auf der blutigen Wiese, wo der Sturm auf La Tourgue begonnen hatte, auf und nieder. Er war ganz ungestört. Das Feuer, dem nunmehr keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, brannte weiter. Radoub war bei den Kindern und der Mutter, fast ebenso mütterlich wie diese. Das Brückenschlößchen war beinahe vernichtet; die Sappeurs isolirten nur noch den Gluthherd. Man warf Gruben auf für die Todten, verband die Verwundeten, riß die Barrikade nieder, entfernte die Leichen aus den Gemächern und von den Treppen, reinigte den Schauplatz des Gemetzels und schaffte den fürchterlichen Kehricht des Sieges bei Seite. Die Soldaten besorgten mit militärischer Hurtigkeit, was man das Hauswesen einer beendigten Schlacht nennen könnte. Aber von dem Allen sah Gauvain nichts. Kaum daß er, aus seiner Träumerei heraus, einen Blick auf den Wachtposten vor der Bresche warf, der auf Cimourdains Befehl verdoppelt worden war. Der Wiesenfleck, wo er gewissermaßen eine Zuflucht gesucht hatte, lag etwa hundert Schritt von der Bresche, deren schwarzen Schlund er in der Dunkelheit unterscheiden konnte. Dort hatte vor drei Stunden der Angriff begonnen; dort war Gauvain in den Thurm eingedrungen; dort befand sich der Saal, wo die Barrikade gestanden; jener Saal führte in den Kerker des Marquis, welcher durch den Wachtposten der Bresche bewacht wurde, und jedes Mal, wenn Gauvains Blick diese Bresche streifte, tönte ihm wie Grabgeläute ein verworrener Nachhall der Worte ins Ohr: »Morgen die Gerichtssitzung, übermorgen die Guillotine.«
Die Feuersbrunst, wiewohl begrenzt und durch die Sappeurs mit allem verfügbaren Wasser begossen, erlosch nicht ohne Widerstand und wirbelte stellenweise noch Flammen auf; hin und wieder hörte man das Gekrach des Gebälks und der aufeinander einstürzenden Stockwerke, und dann sprühte das Schlößchen, wie eine geschwungene Fackel, ganze Wirbel von Funken; der äußerste Horizont erglänzte wie bei einem Blitzstrahl und La Tourgue warf plötzlich einen riesenhaften Schlagschatten bis zum Waldsaum hinüber.
Gauvain, der langsamen Schritts in der Dunkelheit vor der Bresche auf und abging, kreuzte zuweilen beide Hände hinter der Kapuze seines Soldatenmantels, die er über den Kopf geschlagen hatte, und sann.
II.
Gauvain in Gedanken
Es war ein unergründlich tiefes Hinbrüten; hatte doch eine unerhörte Verwandlung soeben stattgefunden. Der Marquis von Lantenac hatte sich verklärt, und diese Verklärung hatte Gauvain mit angesehen. Nie hätte er geglaubt, daß irgend welche Verwickelung von Umständen dergleichen Dinge mit sich bringen könne, und nie, selbst im Schlaf nicht, geahnt, daß so etwas möglich sei. Das Unerwartete, dieses unbestimmte, mit den Menschen spielende herrische Walten, hatte ihn erfaßt und hielt ihn fest. Unter seinen Augen war das Unmögliche, Sichtbare, Greifbare, Unvermeidliche, Unerbittliche Wirklichkeit geworden. Wie stellte sich nun er, Gauvain, zu dieser Thatsache? Nicht Ausflüchte zu suchen galt es hier; es galt, einen Schluß zu ziehen. Es war eine Frage an ihn gerichtet worden, welcher er nicht ausweichen durfte, und wer richtete diese Frage an ihn? Die Ereignisse, und die Ereignisse nicht allein, denn wenn die wandelbaren Ereignisse anfragen, steht die unwandelbare Gerechtigkeit dahinter und fordert Antwort. Hinter der Wolke, die ihren Schatten auf uns wirft, leuchtet der Stern, und wir können, uns dem Licht ebenso wenig entziehen wie dem Schatten.
Gauvain bestand ein Verhör. Er erschien vor einem Richter, einem furchtbar strengen Richter: seinem eigenen Gewissen. Er empfand ein innerliches Taumeln; seine festesten Vorsätze, seine bestimmtesten Versprechungen, seine unwiderruflichsten Entschlüsse, das Alles kam in den Grundfesten seiner Willenskraft in ein Wanken. Wie Erdbeben, so giebt es auch Seelenbeben. Je mehr er dem Gesehenen nachgrübelte, desto tiefer wühlte sich die Umwälzung. Ihm, der als Republikaner das Wahre erfaßt zu haben glaubte und auch erfaßt hatte, erschien nun urplötzlich eine höhere Wahrheit, über der politischen Idee die rein menschliche. Was in ihm vorging, ließ sich nicht bemänteln; der Thatbestand fiel schwer ins Gewicht; Gauvain, der in diesen Thatbestand mit verflochten war, konnte sich nicht zurückziehen, und trotz Cimourdains Versicherung: »Mit Allem, was von jetzt ab geschehen soll, hast Du Dich nicht zu befassen«, fühlte er in seinem Innern etwas Aehnliches wie ein Baum, der von seiner Wurzel losgerissen wird. Jeder Mensch hat eine Grundlage, und jede Erschütterung dieser Grundlage versetzt den Menschen in namenlose Verwirrung; diese Verwirrung war über Gauvain gekommen, und er drückte beide Hände gegen seine Stirn, als wolle er das Richtige daraus hervorpressen.
Eine solche Situation klar zusammenzufassen war kein Leichtes; es gab sogar nichts Schwereres; großmächtige Zahlen ragten vor ihm auf, aus denen er eine Summe ziehen sollte; ein ganzes Schicksal zusammen addiren, wem schwindelt davor nicht? Er machte den Versuch; er rang nach Aufklärung; er mühte sich ab, seine Gedanken zu sammeln, das oder jenes heimliche Widerstreben zu überwältigen, die Thatsachen der Reihe nach zu prüfen und sie sich selber zu erläutern.
Wer hat sich nicht schon einen Selbstbericht erstattet und ist nicht, an Wendepunkten seines Lebens, mit sich zu Rath gegangen, um sich einen Weg. für den Vorstoß oder für den Rückzug vorzuzeichnen?
Gauvain hatte etwas Unerklärliches geschaut. Gleichzeitig mit dem irdischen Kampf war ein himmlischer ausgefochten worden, der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen; in diesem Kampf war ein steinern Herz überwunden worden, und wenn man alle Verdüsterungen dieses Herzens in Betracht zieht, die Gewaltthätigkeit, die Selbsttäuschung, die Blindheit, die krankhafte Verstocktheit, den Hochmuth, die Eigenliebe, so war hier wirklich ein Wunder geschehen: der Sieg der Menschheit über den Menschen. Das Menschliche hatte über das Unmenschliche triumphirt. Und wie hatte es einen Riesen an Zorn und Haß niedergeworfen? Durch welche Mittel? Mit welchen Waffen, welcher Kriegsmaschine? Durch eine bloße Kinderwiege.
Gauvain war wie durch ein Meteor geblendet. Mitten im sozialen Kampf, im Auflodern aller Feindseligkeiten und Rachegelüste, im dunkelsten, wildesten Moment des Aufeinanderprallens, in der Stunde, wo das Verbrechen in seinen hellsten Flammen und der Haß in seiner vollsten Finsterniß aufging, in diesem Augenblick der Schlacht, wo Alles zur Waffe wird und wo das Handgemenge so verhängnißwuchtig tobt, daß man nicht mehr weiß, auf welcher Seite die Gerechtigkeit, die Ehrlichkeit, die Wahrheit zu suchen sind, hatte das unbekannte Etwas, der geheimnißvolle Seelenmahner, über dem menschlichen Licht- und Schattenwiderstreit, urplötzlich den großen ewigen Strahlenborn leuchten lassen. Ueber dem düstern Zweikampf des Falschen und des nur bedingt Richtigen war mit einem Mal, in tiefster Ferne, das Antlitz der Wahrheit erschienen und die Macht der Schwachen zum Durchbruch gekommen. Man hatte drei armselige, kaum geborene, kaum ihrer selbst bewußte, verlassene, verwaiste, vereinsamte, stammelnde, lächelnde Wesen den Sieg davontragen sehen über den Bürgerkrieg, über die systematische Wiedervergeltung, über die gräßliche Logik der Gegenwehr, über den gewaltsamen Tod, das Gemetzel, den Brudermord, die Raserei, den verbissenen Groll, kurz über alle Gorgonen; man hatte eine verruchte, zu einem Verbrechen gedungene Feuersbrunst mißlingen und fehlschlagen gesehen, gesehen, wie ein unmenschlicher Vorbedacht entwaffnet und vereitelt wurde, gesehen, wie die überlieferte Grausamkeit des Mittelalters, die alte unerbittliche Menschenverachtung, die erfahrungsmäßigen angeblichen Nothbehelfe der Kriegführung mitsammt der Staatsräson und den eingefleischten, angemaßten Vorurtheilen eines grausamen Greisenthums in nichts zerstoben waren vor dem blauen Blick Solcher, die noch nicht gelebt hatten: eigentlich ein natürlicher Vorgang, denn wer noch nicht gelebt hat, hat auch noch nicht gesündigt; er ist die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die weiße Reinheit, und in den kleinen Kindern verkörpern sich die Engel des Himmels.
Ein nutzbringend Schauspiel, ein guter Rath, eine Lehre war’s für die maßlosen Kämpfer eines unbarmherzigen Kampfes, plötzlich zu sehen, wie sich im Angesicht all der Unthaten, all der Frevel, all der Parteiwuth, der Blutgier, der scheiterhaufenanfachenden Rache, des fackelschwingenden Todes die Allmacht der Unschuld über die unzählige Legion von Greueln erhob. Und die Unschuld hatte gesiegt. Und jetzt konnte man sagen: Nein, es giebt keinen Bürgerkrieg, es giebt keine Barbarei, giebt keinen Haß, kein Verbrechen, keine Finsterniß mehr, dies Heer von Unholden zu zerstreuen genügte ein einzig Morgenroth: die Kindheit.
In keinen Kampf, niemals, hatte sowohl das Göttliche wie das Teuflische sichtbarlicher eingegriffen. Der Kampfplatz war ein Gewissen gewesen, das Gewissen Lantenacs, und nun brach, noch heißer und noch entscheidender, in einem andern Gewissen der Kampf los, in Gauvains Gewissen. Ein Mensch, welch ein Schlachtfeld! Göttern, Ungeheuern und Riesen sind wir preisgegeben, unsern eigenen Gedanken, und diese wilden Ringer, wie oft zerstampfen sie uns die Seele!
Immer tiefer versank Gauvain in sein Grübeln.
Der Marquis von Lantenac, eingeschlossen, bestürmt, verurtheilt, in Bann und Acht, festgekeilt wie ein Löwe in der Arena, wie der Nagel in der Zange, in seiner kerkergewordenen Höhle gefangen und allenthalben bedrängt von einer feurigen Eisenmauer, hatte ihr zu entrinnen vermocht; er war wie durch ein Wunder entkommen; ihm war ein Meisterstück gelungen, in einem solchen Krieg das schwerste unter allen, die Flucht. Er hatte wieder Besitz ergriffen von seinem Wald, um sich darin zu verschanzen, von der ganzen Umgegend, um darin zu kämpfen, von der Finsterniß, um darin zu verschwinden. Er war der schreckenverbreitende Auf- und Niedertaucher wieder, der düstere Irrfahrer, das Oberhaupt der Unsichtbaren, der Anführer der unterirdischen Männer, der Herr der Wälder. Gauvain hatte den Sieg, Lantenac aber seine Freiheit errungen. Er hatte fortan die vollste Sicherheit, den unbegrenzten Raum, die unerschöpfliche Wahl seiner Schlupfwinkel vor sich; er war ungreifbar, unentdeckbar, unerreichbar; der gefangene Löwe war der Falle entsprungen und in diese Falle war er zurückgekehrt, hatte freiwillig, aus eigenem Antrieb, willkürlich, den Wald und den Schatten und die Geborgenheit und das Asyl seiner Freiheit verlassen, um sich tollkühn in die entsetzlichste Gefahr zu begeben, ein erstes Mal, als er sich in das Gebäude stürzte, das ihn mit dem Untersinken in den Flammen bedrohte, und dann noch ein zweites Mal, als er an jener Leiter hinabstieg, die ihn seinen Feinden überantwortete und die, eine Rettungsleiter für die Anderen, für ihn die Leiter zum Grab war. Und weshalb hatte er das Alles gethan? Um drei Kinder dem Tode zu entreißen. Und was wollte man jetzt mit diesem Mann beginnen? Ihm den Kopf vor die Füße legen. Für drei Kinder – waren es seine Kinder? Nein; gehörten sie wenigstens seiner Familie an? Nein; seiner Kaste? – Nein – für die drei Kinder einer Bettlerin, die nächstbesten, für unbekannte, zerlumpte, halbnackte Findlinge hatte dieser Edelmann, dieser Fürst, dieser Greis, der Gerettete, der Befreite, der Sieger – denn solch ein Entrinnen ist ein Triumph – Alles gewagt, Alles aufs Spiel gesetzt, Alles wieder in Frage gestellt und hatte, in demselben Augenblick, da er die Kinder zurückgab, seinen bis dahin verhaßten, nunmehr aber verehrungswürdigen Kopf mit gebieterischer Ueberlegenheit zurückgebracht und dem Henker angeboten. Und was geschah jetzt? Das Gebotene war angenommen worden. Lantenac hatte die Wahl gehabt zwischen fremdem Leben und zwischen seinem eigenen und hatte sich majestätisch für seinen Tod entschieden. Und den wollte man ihm jetzt zuerkennen, ihm den Tod zur Belohnung seines Heldenthums, wollte auf eine hochherzige That mit einer barbarischen antworten und der Revolution diese Blöße geben! Wie klein müßte da die Republik erscheinen neben dem Marquis! Während der Mann der Vorurtheile und der Unterdrückung, plötzlich umgewandelt, in die Menschheit zurückkehrte, sollten sie, die Männer der Befreiung und der Unabhängigkeit, im Bürgerkrieg verharren, in der Routine des Blutvergießens, im Brudermord! Das göttliche Gesetz der Vergebung, der Selbstverleugnung, der Erlösung, der Opferfreudigkeit sollte also den Verfechtern des Irrthums heilig sein und den Soldaten der Wahrheit nicht! Wie? Sollte man etwa an Großmuth hinter dem Gegner zurückbleiben? Diese Niederlage über sich ergehen lassen? In der Vollkraft sich als der schwächere Theil erweisen, siegreich morden und die Behauptung möglich machen, es ständen auf der Seite der Monarchie Die, welche die Kinder retten, und Die, welche Greise umbringen, seien unter den Republikanern zu suchen? Dieser tapfere Soldat, dieser gewaltige Achtziger, dieser entwaffnete, eher geraubte als gefangene Feind, mitten aus einer edlen That herausgerissen, mit seiner eigenen Erlaubniß festgenommen, noch mit den Schweißperlen einer erhabenen Opferthat auf der Stirn, sollte die Stufen des Schaffotts hinansteigen, wie man hineinsteigt zur Apotheose? An das Fallbeil sollte dieses Haupt ausgeliefert werden, von den bittenden drei Seelen der geretteten kleinen Engel umschwebt? Und bei dieser Selbsterniedrigung seiner Henker sollte Lantenacs Antlitz lächeln und das Antlitz der Republik erröthen? Und in seinem, Gauvains, des Befehlshabers, Beisein sollte das geschehen? Und er, der es verhindern konnte, sollte sich nicht rühren, sich zufrieden geben mit der stolzen Abfertigung: »Mit dem, was von jetzt ab geschehen soll, hast Du Dich nicht zu befassen?« Würde er nicht zu sich selber sagen müssen, daß in solchen Fällen eine Abdankung die Mitschuld ist? Und müßte er sich nicht eingestehen, daß der, welcher eine so ungeheuerliche That zuläßt, noch verwerflicher handelt, als der sie vollbringt, weil er nebenbei noch die Rolle des Feiglings spielt?
Aber hatte er nicht bereits versprochen, den Tod des Marquis herbeizuführen? Hatte er, Gauvain, der Mann der Milde, nicht erklärt, daß Lantenac als Ausnahme außer dem Bereich der Milde stehe und daß er ihn Cimourdain überantworten werde? Diesen Kopf war er schuldig; er zahlte ganz einfach seine Schuld ein. Aber war es denn auch noch derselbe Kopf? Bis jetzt hatte Gauvain in Lantenac lediglich den barbarischen Gegner gesehen, den fanatischen Vorkämpfer des Königthums und der Feudalzustände, den Schlächter der Gefangenen, den durch den Bürgerkrieg losgelassenen Mörder, den Blutmenschen, und jenen Menschen fürchtete er nicht; gegen den Wütherich konnte er wüthen, dem Unversöhnlichen die Unversöhnlichkeit entgegensetzen. So wäre die Sache äußerst einfach und der vorgeschriebene Weg mit düsterer Leichtigkeit einzuhalten gewesen; den Tödtenden tödten war weiter nichts als die gerade Linie des Gräßlichen. Jetzt aber war diese gerade Linie ganz unvermuthet unterbrochen worden und hinter ihrer Krümmung that sich, wie durch eine Offenbarung, ein neuer Gesichtskreis auf. Der unbekannte, verwandelte Lantenac betrat die Bühne. Dem Ungeheuer entstieg ein Held, ja, mehr noch als ein Held, ein Mensch, und mehr noch als eine Seele, ein Gemüth. Gauvain hatte keinen Würger mehr, einen Retter hatte er vor sich. Er war niedergeworfen durch einen himmlischen Lichtstrom; Lantenac hatte ihm einen Donnerschlag der Güte ins Herz geschmettert.
Und dieser verklärte Lantenac sollte Gauvain nicht auch verklären? Was? Auf diesen Strahlenstoß sollte kein Rückstoß erfolgen? Der Mann der Vergangenheit sollte voran- und der Mann der Gegenwart zurückschreiten? Der Mann der Grausamkeit und des Aberglaubens sollte, auf plötzlich ausgebreiteten Schwingen einherschwebend, den Mann des Ideals von oben herab im Staub und in der Nacht kriechen sehen, weiterkriechen im ausgefahrenen Geleise der Rohheit, indessen er, Lantenac, in den Lüften hinsegelte, erhabenen Begegnungen zu?
Und dann noch dies Andere: die Familie! Das Blut, das Gauvain vergießen sollte – denn es vergießen lassen, hieß es selber vergießen – war es nicht sein eigenes? Sein Großvater war gestorben, aber sein Großonkel lebte, und dieser Großonkel war der Marquis. Mußte derjenige der beiden Brüder, der im Grab lag, nicht daraus hervorsteigen, um zu verhindern, daß der andere hinabgestoßen werde? Mußte er nicht seinem Enkel befehlen, fortan diese Krone von weißem Haar, die Schwester seiner eigenen Strahlenkrone, zu ehren, und blitzte nicht zwischen Gauvain und Lantenac der Entrüstungsblick eines Todten? Hatte die Revolution denn die Entartung der Gemüther zum Zweck? War sie gemacht worden, um die Bande der Familie zu sprengen und alles menschliche Fühlen zu ersticken? Im Gegentheil, 89 war ja über der Welt aufgegangen, um diese höchsten Wahrheiten zur Geltung zu bringen und nicht, um sie zu verneinen, denn die Bastillen niederwerfen, heißt die Menschheit befreien, die Feudalherrschaft abschaffen, heißt die Familie begründen. Da der Urheber der Ausgangspunkt der Autorität ist, und da die Autorität dem Urheber innewohnt, giebt es keine andere Autorität als die des Vaters; daher die berechtigte Herrschaft der Bienenkönigin, die ihr Volk gebiert und ihre Königswürde der Mutterschaft entlehnt; daher der Widersinn des Menschenkönigs, der, ohne der Vater zu sein, dennoch der Herr sein will; daher die Absetzung dieses Königs; daher die Republik. Was ging aus dem Allen hervor? Die Familie, die Menschheit, die Revolution. Die Revolution war die Thronbesteigung der Völker und im Grund ist das Volk nichts anderes als das Individuum. Die Frage war so gestellt, ob jetzt, da Lantenac in die Menschheit zurückgekehrt war, Gauvain seinerseits nicht in die Familie zurückkehren werde; die Frage war, ob Oheim und Neffe sich in der höheren Lichtregion zusammenfinden sollten oder ob dem Fortschreiten des Oheims ein Rückschritt des Neffen entsprechen müsse. Auf diese Frage also lief Gauvains erregte Auseinandersetzung mit seinem Gewissen hinaus, und die Antwort schien sich von selber zu ergeben: Rettung für Lantenac.
Wohl, aber Frankreich?
Hier wechselte das schwindelnde Problem plötzlich die Gestalt. Wie? Frankreich lag in den letzten Zügen! Frankreich stand offen, ausgesetzt, ohne Bollwerk; es hatte keinen Wallgraben mehr: Deutschland drang über den Rhein; es hatte keine Mauern mehr: Italien stieg über die Alpen und Spanien über die Pyrenäen. Ihm blieb nur der große Schlund des Ozeans, nur den Abgrund hatte es noch für sich. Dem den Rücken zuwendend, konnte es freilich, auf seine Meere gestützt, dem ganzen Festland die Stirne bieten. Eigentlich war diese Stellung unüberwindlich. Aber nein, diese Stellung war im Rücken bedroht. Dieser Ozean gehört Frankreich nicht mehr. Auf diesem Ozean hausten die Engländer. England wußte allerdings nicht, wie es hinüberkommen sollte, doch siehe da! Es fand sich ein Mann, der ihm eine Brücke bauen wollte, ein Mann, der ihm die Hand reichte, ein Mann, der zu Pitt, zu Craig, zu Cornwallis, zu Dundas, zu den Piratenschiffen sagte: Kommt! Ein Mann, der eben hinüberschreien wollte: Da, England, nimm Frankreich hin! Und dieser Mann war der Marquis von Lantenac und diesen Mann hielt man fest. Nach drei Monaten der Hartnäckigkeit, der Verfolgung, der Hetzjagd, war man seiner endlich habhaft geworden. Gerade war auf den Fluchbeladenen die Hand der Revolution niedergefahren; die zusammengekrampfte Faust von 93 hatte den royalistischen Henker beim Kragen gefaßt, und durch eine Fügung jenes geheimnißvollen Vorbedachts, der von oben herab in die irdischen Ereignisse eingreift, erwartete just in seinem eigenen Stammkerker dieser Muttermörder die Strafe, der mittelalterliche Mensch im mittelalterlichen Burgverließ; die Steine seines Kastells standen wider ihn auf und schlossen sich über ihm, und der sein Vaterland gefangen geben wollte, wurde selber gefangen gegeben durch sein Haus. Das Alles hatte Gott augenscheinlich also angeordnet; die Stunde der Gerechtigkeit hatte geschlagen; die Revolution hatte diesen öffentlichen Widersacher festgenommen; er konnte nicht mehr kämpfen, nicht mehr handeln, nicht mehr schaden; in jener Vendée, die über so viele Arme gebot, war er der einzige Kopf; mit ihm ging der Bürgerkrieg zu Ende; er war gefangen und damit Alles zum tragisch glücklichen Abschluß gekommen; nach so vielen Blutszenen und Metzeleien saß er hinter Schloß und Riegel, und sterben sollte nun auch Der, welcher getödtet hatte. Und dieser Mann hätte einen Retter finden sollen? Cimourdain, das heißt 93, hielt Lantenac, das heißt die Monarchie, in seiner Faust und es sollte sich eine Hand rühren, um der eisernen Kralle diese Beute zu entreißen? Lantenac, derjenige, in dem sich jene Garbe von Plagen zusammenflocht, die man die Vergangenheit nennt, der Marquis von Lantenac lag im Grab; die schwere Pforte der Ewigkeit schlug hinter ihm zu, und es sollte Jemand nahen und von außen den Riegel wieder wegschieben? Dieser soziale Uebelthäter war todt und mit ihm der Aufruhr, der brudermörderische Kampf, der unmenschlich geführte Krieg, und ihn sollte Jemand zurückrufen ins Leben? O wie würde der Todtenkopf dazu lachen! Recht so, würde dieses Gespenst grinsen, da habt ihr mich wieder, ihr dummen Tröpfe! Und wie würde er dann wieder an seine verruchte Arbeit gehen! Mit welcher freudigen Unversöhnlichkeit würde er sich wieder in den Pfuhl des Hasses und der Kriegswuth stürzen! Wie würden, schon am nächsten Tag, die Häuser in Brand gesteckt, die Gefangenen hingeschlachtet, die Verwundeten niedergemacht, die Weiber erschossen werden!
Und jene That, die Gauvain also blendete, maß er ihr denn auch wirklich keinen übertriebenen Werth bei? Drei Kinder waren verloren, und Lantenac hatte sie gerettet. Aber weshalb waren sie verloren? Waren sie’s nicht durch Lantenacs Schuld? Wer hatte jene Wiegen jener Feuersbrunst ausgesetzt? War’s nicht der Imânus? Und was war der Imânus? Das Werkzeug des Marquis. Verantwortlich ist der Befehlshaber. Der Mordbrenner war also kein Anderer als Lantenac. Was hatte er demnach so Bewundernswerthes gethan? Nichts, als daß er von seinem Vorsatz abließ. Nachdem er das Verbrechen zur Hälfte begangen, war er davor zurückgebebt, hatte sich selber Abscheu eingeflößt. Der Schrei der Mutter hatte jenen Rest von angestammtem menschlichen Mitleid in ihm aufgerührt, der als eine Art Ablagerung des allgemeinen organischen Lebens jeder Seele, sogar der ungeheuerlichsten, innewohnt. Bei jenem Schrei hatte er sich umgewendet und war aus der Nacht, in der er sich verlor, zum Licht zurückgekehrt und hatte die Wirkung seines Verbrechens aufgehoben. Sein ganzes Verdienst bestand lediglich darin, daß er nicht bis zum Schluß der Unmensch gewesen.
Und für ein so geringes Verdienst sollte man ihm Alles wiedergeben? Den offenen Raum, die Gefilde, die Ebenen, die Lüfte, den Tag, den Wald ihm wiedergeben, daß er ihn für seine rebellischen Zwecke, die Freiheit, daß er sie zur Knechtung, die Existenz, daß er sie zur Vertilgung anderer ausnütze?
Oder konnte man etwa einen Versuch machen, sich mit ihm zu verständigen, mit seiner gebieterischen Seele zu unterhandeln, ihm bedingungsweise die Befreiung vorzuschlagen, ihn zu fragen, ob er sein Leben mit dem Versprechen erkaufen wolle, sich fortan jeder weiteren Auflehnung und Feindseligkeit zu enthalten? Wie verfehlt wäre solch ein Anerbieten gewesen und welch ein Triumph für ihn! Und mit welch stolzer Geringschätzung könnte er dem Fragenden die Antwort ins Angesicht schlagen: Die Entwürdigungen behaltet für Euch und tödtet mich!
Mit diesem Mann war in der That nichts Anderes zu beginnen, als ihn zu tödten oder zu befreien. Bei ihm gipfelte sich Alles; er war stets bereit, zu entschweben oder sich zu opfern; er war der Adler und der Abgrund seiner selbst, ein psychisches Räthsel. Ihn tödten, welch ein Alp! Ihn befreien, welch eine Verantwortung! War Lantenac frei, so mußte in der Vendée Alles wieder von Neuem begonnen werden; von Neuem mußte man ringen mit dem Lindwurm, dem man den Kopf nicht abgeschlagen. In einem Nu, wie der Blitz, würde die verglimmende Flamme beim ersten Wiedererscheinen dieses Mannes aufflackern, und dieser Mann würde nicht eher ruhen, als bis ihm sein fluchwürdiger Plan gelungen, demzufolge, wie ein Sargdeckel, die Monarchie über die Republik und England über Frankreich geschraubt werden sollte. Lantenac retten, hieß Frankreich opfern; Lantenacs Leben bedeutete den Tod einer Menge von unschuldigen, dem Bürgerkrieg aufs Neue anheimfallenden Wesen, Frauen und Kinder so gut wie Männer; es bedeutete die Landung der Engländer, den Rückprall der Revolution, die Verwüstung der Städte, ein zerfleischtes Volk, eine verblutende Bretagne, ein der Klaue zurückerstattetes Opfer. Und mitten in einem Meer von verworrenen Lichterscheinungen und durcheinander gekreuzten Strahlen sah Gauvain, wie sich allmälig vor seiner hinträumenden Seele das Problem abklärte und aufrichtete: Freigebung des Tigers.
Und dann trat die Frage wieder in ihrer ersten Gestalt an ihn heran; der Sisyphosblock, das Sinnbild des inneren Widerstreits im Menschen, rollte wieder zurück. War Lantenac denn auch wirklich der Tiger? Er mochte ein Tiger gewesen sein; aber war er auch jetzt noch einer? Gauvain empfand die peinlich schwindelnden Windungen des Gedankens, der wie die Schlange in sich selber zurückschnellt. Ließ sich denn schließlich auch nach redlichster Prüfung die Opferthat Lantenacs, seine stoische Selbstverleugnung, seine majestätische Uneigennützigkeit in Abrede stellen? Vor dem aufgerissenen Rachen des Bürgerkrieges der Humanität huldigen, in den Konflikt der untergeordneten Wahrheiten die höhere Wahrheit schleudern, den Beweis führen, daß es über den Königsthronen, über den Revolutionen, über den irdischen Streitfragen noch das endlos zärtliche Hinschmelzen der Seele giebt, die Pflicht der Starken, den Schwachen zu beschützen, die Rettungspflicht der Geretteten gegen die Rettungsbedürftigen, die Vaterpflicht aller Greise gegen alle Waisen – diese Herrlichkeiten zur Geltung bringen und das eigene Haupt dafür einsetzen, General sein und auf den Krieg, auf die Schlachten, auf die Revanche verzichten, Royalist sein und zu einer Wage greifen und auf die eine Schale den König von Frankreich, eine fünfzehnhundertjährige Monarchie, die wiederherzustellenden alten Gesetze, die wiedereinzuführende alte gesellschaftliche Ordnung und auf die andere Schale die nächstbesten drei Bauernkinder legen und den König, den Thron, das Scepter, die fünfzehn Jahrhunderte leicht befinden gegen eine dreifache Unschuld – das Alles sollte so viel sein wie nichts, und Der dies vollbracht, sollte der Tiger bleiben und als Bestie ausgerottet werden? Nein, zehnmal nein! Ein Unmensch war es nicht, der soeben noch den Abgrund des Bürgerkrieges mit dem Strahl einer göttlichen That erhellt hatte! Aus dem Schwertschwinger war ein Lichtspender geworden; der Höllenfürst war wieder Lucifer der Engel. Durch sein Opfer hatte sich Lantenac von allen früher verübten Greueln losgekauft; er hatte sich durch seinen zeitlichen Untergang moralisch gerettet, hatte sich eine neue Unschuld erkämpft, hatte seine eigene Begnadigung unterschrieben, denn es besteht ein Recht der Selbstverzeihung, und von nun an war Lantenac ehrwürdig. Er hatte das Außerordentliche bereits geleistet, und nun kam die Reihe an Gauvain; Gauvain war ihm die Antwort schuldig. Der Widerstreit der edlen und unedlen Leidenschaften hatte dermalen die Welt in ein Chaos zurückgestoßen und diesem hatte Lantenac die Humanität abgerungen; Gauvain fiel nun die Aufgabe zu, dem Chaos noch ein Zweites abzuringen, die Familie. Was mußte geschehen? Konnte Gauvain unterlassen, was Gott selber ihm zutraute? Nimmermehr, und aus seinem Tiefsten heraus flüsterte ihm eine Stimme zu: Retten wir Lantenac! – Nun denn, entgegnete eine andere, thue es nur, arbeite den Engländern nur in die Hände, desertire, lauf über zum Feind, rette Lantenac und werde zum Verräther am Vaterland!
Und er schauderte in sich zusammen.
O Du Träumer, Deine Lösung des Problems ist keine Lösung. – Vor Gauvain stieg in der Finsterniß, die ihn umgab, die düster lächelnde Sphinx auf. Seine Situation glich einem grauenhaften Kreuzweg, in den die widersprechenden Wahrheiten einmündeten und sich einander gegenüberstellten, und wo die drei höchsten Güter des Lebens einander anstarrten: die Menschheit, das Vaterland, die Familie. Jede dieser Wahrheiten ergriff der Reihe nach das Wort und der Reihe nach sagte jede etwas Richtiges. Wie sollte da gewählt werden? Eine um die andere schien den Berührungspunkt der Weisheit und der Billigkeit entdeckt zu haben und mahnte: So mußt Du handeln. Aber mußte wirklich so gehandelt werden? Ja und Nein. Die Vernunft rieth zu Dem, das Gefühl zu Jenem, und die beiden Rathschläge bildeten einen Gegensatz. Die Vernunft ist blos unser Hirn und geht vom Menschlichen aus; das Gefühl ist oft das Gewissen der Weltseele und geht demnach aus vom Uebermenschlichen. Darum auch hat das Gewissen die mindere Klarheit, aber die größere Macht. Und dennoch, was liegt in der strengen Vernunft nicht für eine Gewalt! Gauvain schwankte in grausamer, Rathlosigkeit zwischen zwei Abgründen hin und her: den Marquis verderben oder ihn retten. In einen von beiden mußte er sich stürzen; aus welchem von beiden aber rief die Pflicht?
III.
Der Mantel des Kommandanten.
Die Pflicht und abermals die Pflicht: vor Cimourdain stieg sie düster, vor Gauvain bedrohlich empor, einfach vor Jenem und vor Diesem vielseitig, widerspruchsvoll, verwickelt.
Mittlerweile hatte es Zwölf und Eins geschlagen.
Ohne daß er es merkte, hatte sich Gauvain allmälig der Bresche genähert.
Die Feuersbrunst war zu einer sterbenden Gluth verglommen, deren Widerschein auf das gegenüberliegende Plateau fiel und es in den Zwischenräumen, wo der Rauch sie nicht umwölkte, matt erhellte. Dieser stoßweise auflebende und plötzlich wieder erlöschende Schimmer gab den Gegenständen ein unverhaltnißmäßiges Aussehen und die Schildwachen des Lagers tauchten wie Gespenster darin auf. Aus seiner Traumwelt heraus folgte zuweilen Gauvains Blick mechanisch diesem Untergehen des Qualms im Aufleuchten und des Aufleuchtens im Qualm. Das Auf- und Abwogen der Gluth entsprach einigermaßen der innern Fluth und Ebbe seiner Seele.
Plötzlich warf zwischen dem Aufwirbeln zweier Rauchwolken ein davonfliegender Feuerbrand des verglimmenden Gluthherdes ein grelles Licht auf die höchste Stelle des Plateaus und beschien dort mit röthlichem Glanz die Umrisse eines Karrens. Gauvain schaute hinüber. In diesem Karren, um welchen berittene Gendarmen hielten, glaubte er das Fuhrwerk wiederzuerkennen, das er vor einigen Stunden, bei Sonnenuntergang, durch Guechamp’s Fernrohr betrachtet hatte. Es standen Menschen darauf, die etwas abzuladen schienen, und zwar etwas Schweres, das hin und wieder dumpf durcheinander klirrte; was es eigentlich war, hätte sich schwerlich bestimmen lassen; dem Aussehen nach mochte es wohl Balkenwerk sein. Zwei von den Männern schafften eben eine dreieckige flache Kiste herab, die auf die Erde gestellt wurde. Da erlosch der Feuerbrand und Alles verschwamm wieder im Dunkeln. Nachdenklich starrte Gauvain noch immer hinüber nach dem Plateau, auf dem Laternen angezündet worden waren und undeutliche Gestalten ab und zugingen, die Gauvain, von unten und diesseits der Schlucht, nur dann wahrnahm, wenn sie zum äußersten Rand des Plateaus vortraten. Man hörte auch Stimmen, konnte jedoch keine Worte unterscheiden. Hier und da ertönte es wie von Hammerschlägen auf Holz oder gab jenen eigenthümlichen metallischen Klang, der das Wetzen einer Sense begleitet. Es schlug Zwei.
Langsam wie Einer, der nach zwei Schritten vorwärts am liebsten drei andere wieder rückwärts thun möchte, ging Gauvain auf die Bresche zu. Als er näher kam, erkannte ihn die Schildwache trotz der Dunkelheit an der
goldenen Borte seines Mantels und präsentirte das Gewehr. Nun trat Gauvain in den ebenerdigen Saal, der jetzt in eine Wachtstube umgewandelt worden; die Laterne, die von der Decke herunterhing, gab gerade so viel Licht, daß man durch das Gemach schreiten konnte, ohne über die am Boden auf Stroh ausgestreckten Soldaten des Postens zu stolpern, die fast alle schliefen. Da wo sie vor wenig Stunden noch gekämpft, schlummerten sie jetzt, zwar nicht gerade bequem, denn auf den mangelhaft gekehrten Steinplatten kam mancher noch auf ein von der Schlacht übrig gebliebenes Eisen- oder Bleigeschoß zu liegen; aber sie waren müde und rasteten wenigstens aus. Auf dieser gräßlichen Stätte des ersten Angriffs war gebrüllt, geheult, mit den Zähnen geknirscht, geschlagen, gewürgt, geröchelt worden; auf diesem Fußboden, der ihnen nun als Lager diente, waren gar viele der Ihrigen getroffen niedergestürzt; das Stroh, auf dem sie ruhten, trank das Blut ihrer Kameraden; jetzt war Alles vorüber, man hatte das Blut fortgespült, die Säbel abgewischt; die Todten waren todt und die Ueberlebenden friedlich eingeschlummert. So will es der Krieg. Und auch in der nächsten Nacht sollte ebenso friedlich geschlafen werden.
Als Gauvain erschien, erhoben sich Diejenigen, die blos dämmerten, und unter diesen der Kommandirende des Wachtpostens, vom Boden. Gauvain deutete nach der Kerkerthür und sagte: Machen Sie mir auf. Die Riegel wurden zurückgeschoben und Gauvain trat durch die geöffnete Thür ein, die sich sofort wieder hinter ihm schloß.