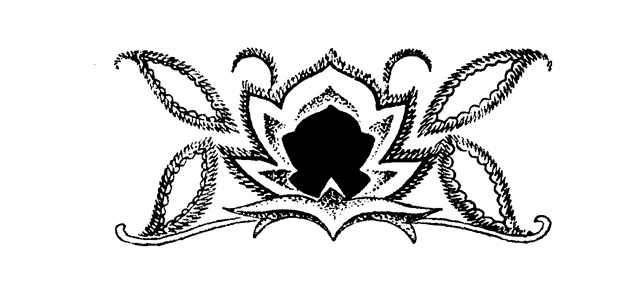1. Novelle
(Übersetzung von Karl Witte)
Herr Chapelet täuscht einen frommen Pater durch eine falsche Beichte und stirbt. Trotz des schlechten Lebenswandels, den er geführt, kommt er nach seinem Tode in den Ruf der Heiligkeit und wird Sankt Chapelet genannt.
Es ziemt sich, ihr liebwerten Damen, ein jedes Ding, das der Mensch unternimmt, mit dem heiligen und wunderbaren Namen dessen zu beginnen, der alle Dinge geschaffen hat. Darum denke ich denn, der ich als erster bei unseren Erzählungen den Anfang machen soll, mit einer jener wunderbaren Fügungen zu beginnen, deren Kunde unser Vertrauen auf ihn als den Unwandelbaren bestärken und uns lehren wird, seinen Namen immerdar zu preisen. Es ist offenbar, daß die weltlichen Dinge insgesamt vergänglich und sterblich sowie nach innen und nach außen reich an Leiden, Qual und Mühe sind und unzähligen Gefahren unterliegen, welchen wir, die wir mitten unter ihnen leben und selbst ein Teil von ihnen sind, weder widerstehen noch uns ihrer erwehren könnten, wenn uns Gottes besondere Gnade nicht die nötige Kraft und Fürsorge verliehe. Was diese Gnade anbetrifft, so haben wir uns keineswegs einzubilden, daß sie um irgendeines Verdienstes willen, das wir hätten, über uns komme, vielmehr geht sie nur von seiner eigenen Huld aus und wird den Bitten derer gewährt, die einst wie wir sterblich waren, jetzt aber, weil sie während ihres Erdenwallens seinem Willen folgten, mit ihm im Himmel der ewigen Seligkeit teilhaftig sind. An sie, als an Fürsprecher, die unsere Schwäche und Gebrechlichkeit aus eigener Erfahrung kennen, richten wir vor allem jene Bitten, die wir vielleicht nicht wagten, unserem höchsten Richter gegenüber laut werden zu lassen. Um so überschwenglichere Gnade haben wir aber in ihm zu erkennen, wenn wir, deren sterbliches Auge auf keine Weise in das Geheimnis des göttlichen Willens eindringen kann, durch falschen Wahn betrogen, einen zu unserem Fürsprecher vor der Majestät Gottes erwählen, den er von seinem Angesicht verbannt hat, und wenn er, vor dem nichts verborgen ist, dessen ungeachtet mehr auf die reine Gesinnung des Bittenden als auf dessen Unwissenheit oder auf des Angerufenen Verdammung sieht und das Gebet ebenso erhört, als ob der vermeintliche Fürsprecher die Seligkeit, ihn zu schauen, genösse. Daß es sich so verhält, wird aus der Geschichte offenbar werden, die ich euch erzählen will. Offenbar nach menschlichem Dafürhalten, sage ich, da Gottes Ratschlüsse uns verborgen bleiben.
Es wird nämlich berichtet, daß Musciatto Franzesi, als er von einem reichen und angesehenen Kaufherrn zum Edelmanne geworden war und nun mit dem Bruder des Königs von Frankreich, dem vom Papst Bonifaz herbeigerufenen und unterstützten Karl ohne Land, nach Toskana ziehen sollte, sich entschloß, seine Geschäfte, welche, wie es bei Kaufleuten der Fall zu sein pflegt, äußerst verwickelt waren, mehreren Bevollmächtigten zu übertragen. Für alles fand er Rat, nur blieb ungewiß, wo er jemanden auftreiben wollte, der geschickt wäre, jene Schulden einzutreiben, die er bei einigen Burgundern ausstehen hatte. Der Grund seines Bedenkens lag darin, daß ihm wohlbekannt war, was für ein wortbrüchiges, händelsüchtiges und abscheuliches Volk die Burgunder sind und daß er sich auf niemand besinnen konnte, der abgefeimt genug gewesen wäre, um ihrer Bösartigkeit mit Erfolg Widerpart zu leisten. Als er in solchem Zweifel lange hin und her überlegt hatte, fiel ihm ein gewisser Ciapperello von Prato ein, der sein Haus in Paris oft zu besuchen pflegte. Die Franzosen, die den Namen Ciapperello nicht verstanden und der Meinung waren, er wolle so viel sagen wie chapeau, was in ihrer Landessprache Kranz bedeutet, nannten diesen Mann, der klein von Gestalt und sehr geschniegelt war, seiner Kleinheit halber nicht Chapeau, sondern Chapelet, unter welchem Namen er denn überall bekannt war, während nur wenige wußten, daß er Ciapperello hieß.
Das Leben, das dieser Chapelet führte, war folgendermaßen beschaffen: In seinem Beruf als Notar hätte er es für eine große Schande gehalten, wenn eine der von ihm ausgestellten Urkunden, obgleich er deren wenige ausstellte, anders als gefälscht befunden worden wäre. Solcher falschen Urkunden aber machte er, soviel man nur wollte, und dergleichen lieber umsonst als rechtmäßige für schwere Bezahlung. Falsches Zeugnis legte er auf Verlangen und aus freien Stücken besonders gern ab, und da in Frankreich Eidschwüre um jene Zeit in höchstem Ansehen standen, gewann er, da er sich nicht um einen Meineid scherte, auf unrechtmäßige Weise alle Prozesse, in denen er die Wahrheit nach seinem Gewissen zu beschwören berufen ward. Ausnehmendes Wohlgefallen fand er daran, und großen Fleiß verwandte er darauf, unter Freunden, Verwandten und was sonst immer für Leuten Unfrieden und Feindschaft anzuzetteln, und je größeres Unglück daraus entstand, desto mehr freute er sich. Wurde er aufgefordert, jemand umbringen zu helfen oder an einer anderen Schandtat teilzunehmen, so weigerte er sich niemals und war der erste auf dem Platz. Oft war er auch bereit, mit eigenen Händen zu ermorden und zu verwunden. In seiner beispiellosen Jähheit lästerte er Gott und alle Heiligen um jeder Kleinigkeit willen auf das gräßlichste. In der Kirche ließ er sich niemals antreffen und verspottete alle christlichen Sakramente mit den verruchtesten Worten. Um so mehr war er dafür in den Schenken und anderen Sündenhäusern. Aus Rauben und Stehlen hätte er sich ebensowenig ein Gewissen gemacht, als ein Heiliger daraus, Almosen zu geben. Er fraß und soff in solchem Übermaß, daß er mehrmals knapp mit dem Leben davonkam. Spielen und im Spiel betrügen betrieb er wie ein Handwerk. Doch wozu so viele Worte! Genug, er war der schändlichste Mensch, der vielleicht je geboren ward, und schon seit langer Zeit konnten nur die Macht und das Ansehen des Herrn Musciatto ihm bei seinen Verbrechen durchhelfen, so daß weder Einzelpersonen, die er häufig, noch die Gerichte, die er fortwährend beleidigte, Hand an ihn legten.
Dieser Ciapperello war es, den Herr Musciatto, welcher seinen Lebenswandel sehr genau kannte, jetzt als den rechten Mann auserkor, um der burgundischen Bosheit die Spitze zu bieten. So ließ er ihn denn rufen und sprach zu ihm: »Chapelet, ich stehe, wie du weißt, im Begriff, ganz von hier wegzuziehen, und da ich unter anderm noch mit einer Anzahl von Burgundern zu tun habe, so kenne ich niemand, dem ich mich besser als dir anvertrauen könnte, um von so betrügerischem Volk mein Geld einzutreiben. Du hast jetzt nichts zu tun, und wenn du diese Angelegenheit übernehmen willst, so verspreche ich dir, dich mit den Gerichten auszusöhnen und dir an dem, was du für mich eintreibst, einen Anteil zu lassen, daß du zufrieden sein kannst.« Herr Chapelet, der müßig ging, auch an irdischen Gütern keinen Überfluß hatte und nun den verlieren sollte, der lange Zeit sein Stecken und Stab gewesen war, sagte ohne langes Besinnen und gewissermaßen notgedrungen, ja, er sei gern bereit.
Nach gehöriger Verabredung und nach Empfang der Vollmacht des Herrn Musciatto und der Gnadenbriefe des Königs reiste Chapelet, als Herr Musciatto Paris verlassen, nach Burgund, wo ihn fast niemand kannte. Hier fing er, wider seine Natur, ganz freundlich und sanftmütig an, seinen Auftrag auszuführen und die Schulden einzufordern, gleichsam als wollte er sich die Bosheit bis zuletzt aufsparen.
Inzwischen war Chapelet ins Haus zweier Brüder aus Florenz gezogen, die Geld auf Wucherzinsen liehen und ihm, Herrn Musciatto zuliebe, viel Ehre erwiesen. In deren Hause erkrankte er jetzt, und obgleich die beiden Brüder ihm sogleich geschickte Ärzte rufen, ihn durch ihre Diener pflegen ließen und überhaupt alles taten, was zu seiner Heilung förderlich sein konnte, so war doch jede Hilfe vergeblich. Dem guten Mann, der nachgerade alt geworden war und liederlich gelebt hatte, ging es nach der Aussage der Ärzte täglich schlechter und schlechter, und es zeigte sich zum großen Leidwesen der Brüder gar bald, daß Chapelet an keiner anderen Krankheit als der des nahen Todes leide.
Diese beiden Brüder nun fingen eines Tages nicht weit von dem Zimmer, wo Chapelet krank lag, folgendermaßen zu reden an: »Was sollen wir mit dem Menschen anfangen«, sagte der eine zum andern. »Wir sind auf jeden Fall seinetwegen in einer sehr verdrießlichen Lage. Ihn jetzt, krank wie er ist, aus dem Hause zu weisen, wäre gewiß unserem Ruf ebenso nachteilig wie unüberlegt von unserer Seite; denn die Leute, die gesehen haben, wie wir ihn erst aufgenommen und für seine Pflege und Heilung gesorgt, wären überzeugt, daß er uns keinen Grund gegeben haben könne, ihn nun als einen Todkranken aus dem Hause zu tun. Auf der anderen Seite aber ist er ein so gottloser Mensch gewesen, daß er weder wird beichten, noch das Abendmahl oder die letzte Ölung wird annehmen wollen, und stirbt er, ohne gebeichtet zu haben, so nimmt keine Kirche den Leichnam auf, und er wird wie ein toter Hund in die Grube geworfen. Sollte er aber auch beichten, so sind seine Sünden so zahlreich und so verrucht, daß nichts dadurch gebessert wird; denn es wird sich weder Mönch noch Pfaffe finden, der ihn lossprechen könnte oder wollte, und stirbt er ohne Absolution, so schmeißen sie ihn auch in die Grube. Kommt es aber so oder so, immer wird das ganze Volk, das ohnehin wegen unseres von ihm verabscheuten Gewerbes äußerst schlecht auf uns zu sprechen ist und Lust genug haben mag, uns auszuplündern, offen gegen uns aufstehen und sagen: ‚Diese Hunde von Italienern, die man in der Kirche abweist, wollen wir nicht mehr unter uns dulden.‘ Sie werden unser Haus stürmen und sich kein Gewissen daraus machen, uns nicht nur Hab und Gut zu nehmen, sondern gar leicht sich an unserem Leib und Leben vergreifen. So sind wir denn auf alle Fälle bei Chapelets Tod übel daran.«
Herr Chapelet, der, wie gesagt, ganz nahe bei dem Orte lag, wo die beiden redeten, und wie man es oft bei Kranken findet, ein feines Gehör hatte, verstand alles, was sie über ihn sagten. Er ließ sie zu sich rufen und sprach: »Ich wünsche nicht, daß ihr euch meinetwegen Gedanken macht oder in Furcht seid, daß euch jemand um meinetwillen kränken möchte. Ich habe gehört, was ihr über mich gesprochen habt, und ich bin wohl überzeugt, daß es so käme, wir ihr sagt, wenn das geschähe, was ihr voraussetzt; aber es soll schon anders gehen. Ich habe zu meinen Lebzeiten unserem Herrgott so viel zuleide getan, daß jetzt, wo ich sterbe, ein Streich mehr auch keinen Unterschied machen wird. Darum schafft mir nur den erfahrensten und frömmsten Mönch herbei, den ihr zu finden wißt, und habt ihr den, so laßt mich nur machen. Ich werde eure und meine Angelegenheit schon so besorgen, daß alles gut sein wird und ihr Ursache habt, zufrieden zu sein.«
Obgleich die beiden Brüder daraus noch keine besondere Hoffnung schöpften, gingen sie doch in ein Mönchskloster und verlangten nach einem frommen und verständigen Manne, der einem Italiener, welcher bei ihnen krank liege, die Beichte hören könnte. Man gab ihnen einen bejahrten Mönch mit, der ein heiliges, makelloses Leben führte, ein großer Schriftgelehrter und gar ehrwürdiger Mann war und bei allen Bürgern im besonderen und hohen Ansehen der Heiligkeit stand. Diesen brachten sie zu dem Kranken.
Als er in die Kammer eingetreten war, wo Chapelet lag, und sich an sein Bett gesetzt hatte, hub er freundlich an, ihm Mut zuzusprechen; und dann erst fragte er ihn, wie lange es her sei, daß er zum letzten Male gebeichtet habe. Chapelet, der sein Leben lang nicht gebeichtet hatte, antwortete ihm: »Ehrwürdiger Vater, sonst ist es meine Gewohnheit, alle Woche wenigstens einmal zur Beichte zu gehen, die vielen Male ungerechnet, wo ich öfter gehe; aber ich muß gestehen, jetzt, wo ich krank geworden bin, sind schon acht Tage vergangen, ohne daß ich gebeichtet hätte, soviel Schmerzen hat die Krankheit mir bereitet.«
»Mein Sohn«, sagte darauf der Mönch, »daran hast du wohlgetan, und also magst du auch in Zukunft tun. Doch da du so oft beichtest, so sehe ich wohl, ich werde wenig Mühe haben, dich zu fragen und deine Antworten anzuhören.« Chapelet sprach: »Herr Pater, sagt das nicht; wie oft und wie vielmals ich auch zur Beichte gegangen bin, so habe ich mich doch nie entschließen können, anders zu verfahren, als eine Generalbeichte aller meiner Sünden vom Tage meiner Geburt an bis zum Beichttag abzulegen. Darum bitte ich Euch, bester Vater, daß Ihr mich ebenso genau über alles ausfragt, als ob ich nie gebeichtet hätte. Und schont mich nur ja nicht etwa, weil ich krank bin; denn ich will viel lieber dieses mein Fleisch plagen, als aus Schonung dafür irgend etwas tun, was meiner unsterblichen Seele, die mein Heiland mit seinem kostbaren Blute losgekauft hat, zum Verderben gereichen könnte.« Diese Worte hatten den ganzen Beifall des heiligen Mannes und schienen ihm von einem gesammelten Gemüt Zeugnis zu geben.
Nachdem er also diese Gewohnheit Chapelet gegenüber sehr gelobt hatte, fing er an, ihn zu befragen, ob er sich je mit Weibern in Wollust versündigt habe. Chapelet antwortete ihm mit einem Seufzer: »Mein Vater, was das anbetrifft, so schäme ich mich, Euch die Wahrheit zu sagen, denn ich fürchte, sie könnte als eitles Selbstlob ausgelegt werden.« Der heilige Pater entgegnete: »Rede nur ruhig; denn wer die Wahrheit spricht, sei es in der Beichte oder bei anderer Gelegenheit, der sündigt niemals.« »Nun denn«, erwiderte Chapelet, »weil Ihr mich darüber beruhigt, so will ich Euch nur sagen, ich bin noch ebenso rein und unbefleckt, wie ich aus dem Schoße meiner Mutter hervorkam.« »Des möge Gott dich segnen«, sagte der Mönch, »Wie wohl hast du daran getan! Und um so verdienstlicher ist deine Keuschheit, da du, wenn du gewollt hättest, weit eher das Gegenteil tun konntest als wir und alle andern, die durch eine Ordensregel gebunden sind.«
Hierauf fragte er ihn, ob er sich je durch Völlerei Gottes Mißfallen zugezogen habe. Mit einem lauten Seufzer antwortete Chapelet: »Allerdings und oftmals.« Denn weil er sich daran gewöhnt habe, außer den vierzigtägigen Fasten, welche fromme Leute jährlich halten, auch allwöchentlich wenigstens drei Tage lang mit Wasser und Brot zu fasten, so habe er das Wasser, vor allem wenn er von Gebeten oder Wallfahrten besonders angestrengt gewesen sei, mit derselben Lust und demselben Wohlgefallen getrunken wie der größte Säufer den Wein. Manchmal habe es ihn auch nach Kräutersalat gelüstet, wie ihn die Bäuerinnen machen, wenn sie aufs Feld gehen, und das Essen habe ihm besser geschmeckt, als es seiner Ansicht nach einem schmecken dürfe, der aus Gottesfurcht faste, wie er es doch getan habe. »Mein Sohn«, sagte darauf der Mönch, »das sind Sünden, welche die Natur mit sich bringt; die haben wenig zu bedeuten, und um ihretwillen möchte ich nicht, daß du dein Gewissen mehr als not tut beschwertest. Es geschieht jedem Menschen, wenn er auch noch so heilig ist, daß ihm nach langem Fasten das Essen gut schmeckt und nach großer Anstrengung das Trinken.« »Ach, Herr Pater«, antwortete Chapelet, »Ihr sprecht so, um mich zu beruhigen. Das solltet Ihr nicht tun. Euch ist ja bekannt, daß ich wohl weiß, wie alles, was man tut, um Gott zu dienen, in ganz reiner Gesinnung, frei von jeder befleckenden Lust getan werden muß und daß, wer dem zuwiderhandelt, sündigt.«
Höchlich zufrieden sagte der Mönch: »Nun, so freut es mich, daß du es so ansiehst, und ich lobe in diesem Stück dein ängstliches und sorgsames Gewissen. Aber sage mir: Hast du dich durch Geiz vergangen und mehr verlangt, als du verlangen solltest, oder behalten, was du nicht behalten durftest?« »Ehrwürdiger Vater«, erwiderte ihm Chapelet, »es sollte mir leid tun, wenn Ihr eine falsche Meinung von mir hättet, weil ich bei den Wucherern hier wohne. Ich habe keinen Teil an ihrem Handwerk; vielmehr bin ich zu ihnen gekommen, um ihnen ins Gewissen zu reden und sie von diesem abscheulichen Erwerbe abzubringen. Auch wäre mir das, wie ich glaube, gelungen, hätte mich Gott nicht so heimgesucht. Ich kann Euch aber sagen, daß mein Vater mir ein schönes Vermögen hinterließ, von dem ich nach seinem Tode den größeren Teil als Almosen weggab. Dann habe ich, um mich zu ernähren und den Armen Gottes beistehen zu können, meinen kleinen Handel getrieben und dabei allerdings den Erwerb im Auge gehabt; was ich aber erworben habe, das habe ich immer mit den Armen gleichmäßig geteilt und meine Hälfte zu meiner Notdurft verbraucht, die andere aber jenen geschenkt. Dafür hat mir aber auch mein Schöpfer beigestanden, so daß meine Geschäfte täglich besser und besser gegangen sind.«
»Daran hast du wohlgetan«, sagte der Mönch. »Aber hast du dich etwa häufig erzürnt?« »Ja«, sagte Herr Chapelet, »das habe ich freilich gar oft getan. Und wer könnte sich wohl dessen enthalten, wenn er die Menschen alle Tage die abscheulichsten Dinge treiben sieht, wenn er beobachtet, wie sie Gottes Gebote nicht halten und sein Gericht nicht fürchten? Wohl zehnmal des Tages habe ich lieber tot als lebendig sein wollen, wenn ich sah, wie die jungen Leute den Eitelkeiten der Welt nachliefen, schworen und sich verschworen, in die Schenken, aber um die Kirche herumgingen und weit mehr auf den Wegen der Welt als auf dem Pfade Gottes wandelten.« Darauf erwiderte der Mönch: »Mein Sohn, das ist ein edler Zorn, um dessentwillen ich für mein Teil dir keine Buße aufzuerlegen wüßte. Sage nur aber, wäre es vielleicht möglich, daß du dich irgendeinmal vom Zorn zu einem Mord, zu Schlägereien oder zu Schimpfworten hättest verleiten lassen?« »Ach du meine Güte, Herr Pater«, sagte Chapelet, »ich halte Euch für einen Mann Gottes; wie könnt Ihr doch solche Reden führen. Glaubt Ihr denn, ich bildete mir ein, daß Gott mich so lange am Leben erhalten hätte, wenn mir nur der entfernteste Gedanke gekommen wäre, etwas von dem zu tun, was Ihr da genannt habt? Dergleichen können ja nur Mörder und Straßenräuber tun; sooft ich dergleichen gesehen, habe ich immer gesagt: Geh, und Gott bessere dich.«
»Gott segne dich, mein Sohn«, sprach der Pater. »So sage mir denn, ob du jemals gegen irgendwen falsches Zeugnis abgelegt oder von andern schlecht gesprochen oder wider Willen des Eigentümers dich an fremdem Gute bereichert hast.« »Ach ja, Herr Pater«, sagte Chapelet, »was die üble Nachrede betrifft, freilich ja. Denn einmal hatte ich einen Nachbarn, der seine Frau in einem fort prügelte, ohne den geringsten Anlaß zu haben. Da hat mich denn das Mitleid mit dem armen Weibe, das er, sooft er sich betrunken hatte, jämmerlich zurichtete, einmal so gepackt, daß ich gegen ihre Verwandten recht auf ihn gescholten habe.« »Wohl denn«, antwortete der Mönch, »nun sage mir aber, wie ich höre, so bist du ein Kaufmann gewesen; hast du niemals jemand nach Art der Kaufleute betrogen?« »Ja, wahrhaftig, Herr Pater«, sagte Herr Chapelet, »Wie er hieß, das weiß ich aber nicht. Es war einer, der mir Geld brachte, was er für ein Stück Tuch schuldig war, das ich ihm verkauft hatte. Nun tat ich das Geld, ohne es zu zählen, in einen Kasten, und reichlich einen Monat später fand ich, daß es vier Heller mehr waren, als mir zukamen. Wohl ein ganzes Jahr lang habe ich sie aufgehoben; weil ich aber den, dem sie gehörten, in der ganzen Zeit nicht mehr wiedersah, habe ich sie am Ende als Almosen verschenkt.« »Das war eine Kleinigkeit«, sagte der Mönch, »und du hast recht daran getan, so damit zu verfahren.«
Der fromme Mönch fragte ihn noch mancherlei, worauf er immer in dieser Weise antwortete. So wollte denn jener schon zur Absolution schreiten, als Chapelet sprach: »Herr Pater, noch eine Sünde habe ich auf dem Gewissen, die ich Euch nicht gebeichtet.« »Und die wäre?« sagte der Mönch. »Ich entsinne mich«, antwortete jener, »daß ich an einem Samstag gegen Abend von meinem Diener das Haus kehren ließ und also die schuldige Ehrfurcht vor dem Tage des Herrn vergessen habe.« »Mein Sohn«, erwiderte der Geistliche, »das hat weiter nichts zu bedeuten.« »Sagt nicht, das habe nichts zu bedeuten«, entgegnete Chapelet. »Den Sonntag soll man ehren; denn an diesem Tag war es, daß unser Heiland von den Toten auferstand.« Darauf sagte der Mönch: »Und hast du sonst noch etwas zu beichten?« »Ja, Herr Pater«, antwortete Chapelet, »einmal habe ich in Gedanken in der Kirche ausgespuckt.« Der Mönch fing an zu lächeln und sagte: »Mein Sohn, das sind Dinge, die man sich nicht zu Herzen nehmen soll; wir sind Geistliche und spucken alle Tage in der Kirche aus.« »Und tut daran sehr übel«, sprach Herr Chapelet; »denn nichts auf der Welt soll man so rein halten wie den Tempel des Herrn, in dem man dem Höchsten opfert.«
Um es kurz zu machen, Sünden von dieser Art beichtete er ihm noch eine Menge. Dann fing er an zu seufzen und brach in einen Strom von Tränen aus, deren ihm, wenn er wollte, immer reichlich zu Gebote standen. »Was ist dir, mein Sohn?« sagte der Geistliche. »Ach, Herr Pater«, erwiderte Chapelet, »eine Sünde habe ich noch auf dem Herzen, die habe ich nie gebeichtet, so schäme ich mich, sie zu bekennen; wenn ich nur daran denke, so weine ich, wie Ihr mich jetzt weinen seht, und um dieser Sünde willen kann ich nur auch nicht denken, daß Gott Erbarmen mit mir haben wird.« »Schäme dich, mein Sohn«, entgegnete der Mönch, »was redest du da? Wären alle Sünden, die von allen Menschen jemals zusammen begangen worden sind oder, solange die Welt stehen wird, noch von den Menschen begangen werden, in einem einzigen Menschen vereinigt, und der wäre reuig und zerknirscht, wie ich sehe, daß du es bist, so ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit so groß, daß er sie alle, sobald sie gebeichtet wären, ihm freudig vergeben würde; und so sage denn zuversichtlich, was du getan hast.« Darauf sprach Herr Chapelet, ohne vom Weinen abzulassen: »Ach, ehrwürdiger Vater, es ist eine gar zu schwere Sünde, und wenn es nicht auf Eure Fürbitte hin geschieht, so kann ich kaum glauben, daß Gott sie mir jemals vergeben sollte.« Der Mönch antwortete ihm: »Sage sie nur ruhig, denn ich verspreche dir, daß ich für dich zu Gott beten werde.« Herr Chapelet weinte noch in einem fort und schwieg; der Mönch aber ermunterte ihn erneut, zu reden. Als nun Chapelet den Geistlichen so mit Weinen eine lange Weile hingehalten hatte, stieß er einen tiefen Seufzer aus und sprach: »Ehrwürdiger Vater, weil Ihr mir denn versprochen habt, Gott für mich zu bitten, so will ich’s Euch sagen. Wißt denn, wie ich noch klein war, habe ich einmal meine Mutter geschmäht.« Und kaum hatte er so gesprochen, so hub er von neuem bitterlich zu weinen an. »Mein Sohn«, antwortete der Mönch, »dünkt dich denn das wirklich solch eine schwere Sünde? Lästern die Leute nicht etwa täglich ihren Herrgott? Und doch vergibt er gern einem jeden, der bereut, ihn gelästert zu haben. Und du verzweifelst, für diesen Fehltritt Vergebung zu finden? Fasse Mut und weine nicht; denn wahrlich, wärest du einer von denen gewesen, die unsern Herrn ans Kreuz geschlagen haben, und wärest du so zerknirscht, wie ich es jetzt an dir sehe, so vergäbe er dir.« Darauf sagte Chapelet: »Um Himmels willen, Herr Pater, was sprecht Ihr da? Allzusehr habe ich mich vergangen, und allzu große Sünde war es, daß ich meine Herzensmutter schmähte, die mich neun Monate lang Tag und Nacht im Leibe getragen hat und mich mehr als hundertmal auf den Armen hielt; und wenn Ihr nicht für mich betet, so wird mir’s auch nicht verziehen werden.«
Als der Mönch inneward, daß Chapelet weiter nichts zu sagen hatte, sprach er ihn los und gab ihm in der festen Überzeugung, Chapelet, dessen Reden er für lautere Wahrheit nahm, sei ein frommer, gottseliger Mensch, den Segen. Und wer möchte wohl zweifeln, wenn er jemand auf dem Totenbette also reden hörte? Nach dem allen sagte er: »Herr Chapelet, Ihr werdet mit Gottes Hilfe bald wieder gesund sein; sollte es aber dennoch geschehen, daß Gott Eure gesegnete und zum Abschied von dieser Welt bereite Seele zu sich riefe, hättet Ihr alsdann etwas dawider, daß Euer Körper in unserem Kloster beerdigt würde?« »Durchaus nicht«, entgegnete Chapelet; »vielmehr möchte ich sonst nirgends liegen als eben bei Euch. Ihr habt mir ja versprochen, für mich zu beten, und auch ohne das habe ich von jeher besondere Ehrfurcht für Euren Orden gehabt. Und so bitte ich Euch, daß Ihr Christi wahrhaftigen Leib, den Ihr diesen Morgen auf dem Altare eingesegnet habt, mir zusendet, sobald Ihr in Euer Kloster zurückgekommen seid. Denn ich denke ihn, wenn Ihr es gestattet, obgleich unwürdig, zu genießen und dann die letzte heilige Ölung zu empfangen, damit ich, wenn ich als Sünder gelebt habe, wenigstens als Christ sterben möge.« Der heilige Mann sagte, das sei wohl gesprochen und er sei alles zufrieden. Das Sakrament solle dem Kranken sogleich gebracht werden. Und so geschah es.
Die beiden Brüder hatten sehr gefürchtet, Chapelet werde sie täuschen, und sich deshalb der Bretterwand nahe gesetzt, welche die Kammer, in welcher der Kranke lag, von der anstoßenden trennte. Hier hatten sie die ganze Beichte belauscht und bequem verstanden, was Chapelet dem Mönche gesagt. Mehr als einmal reizten die Geschichten, die sie ihn beichten hörten, sie so sehr zum Lachen, daß wenig daran fehlte, so wären sie damit herausgeplatzt. Dann aber sagten sie wieder zueinander: »Himmel, welch ein Mensch ist das, den weder Alter noch Krankheit, noch Furcht vor dem Tode, dem er sich nahe sieht, oder vor Gott, vor dessen Richterstuhl er in wenigen Stunden zu stehen vermuten muß, von seiner Verruchtheit haben abbringen und zu dem Entschluß führen können, anders zu sterben, als er gelebt hat.« Indes, sie hatten gehört, seine Leiche solle in der Kirche aufgenommen werden, und um das Übrige kümmerten sie sich nicht. — Herr Chapelet empfing bald darauf das Abendmahl, dann, als sein Befinden sich über die Maßen verschlechterte, die letzte Ölung und starb noch am Tage seiner musterhaften Beichte, bald nach der Vesper.
Die beiden Brüder besorgten aus dem Nachlaß des Verstorbenen ein anständiges Begräbnis und meldeten den Todesfall im Kloster, damit die Mönche, wie es der Brauch ist, die Nachtwache bei der Leiche halten und sie am andern Morgen abholen sollten.
Der fromme Mönch, der sein Beichtiger gewesen war, besprach sich, als er seinen Tod vernahm, mit dem Prior des Klosters. Er ließ zum Kapitel läuten und schilderte den versammelten Mönchen, welch ein frommer Mann Chapelet, seiner Beichte zufolge, gewesen war. In der Hoffnung, daß Gott durch ihn noch große Wunder verrichten werde, überredete er sie, man müsse diese Leiche notwendig mit besonderer Auszeichnung und Ehrfurcht empfangen. Der Prior und die übrigen Mönche pflichteten in ihrer Leichtgläubigkeit dieser Meinung bei, und so gingen sie denn sämtlich noch spät am Abend in das Haus, wo Chapelets Leichnam lag, und hielten über diesem eine große und feierliche Vigilie.
Am andern Morgen kamen sie alle, mit Chorhemden und Mäntelchen angetan, die Chorbücher in der Hand und die Kreuze voraus, um den Leichnam mit Gesang zu holen. Dann trugen sie ihn unter Gepränge und großer Feierlichkeit in ihre Kirche, und fast die ganze Einwohnerschaft des Städtchens, Männer und Frauen, schloß sich dem Zuge an. Als die Leiche in der Kirche niedergesetzt worden war, stieg der Geistliche, dem Chapelet gebeichtet hatte, auf die Kanzel und berichtete von des Verstorbenen frommem Leben, von seinem Fasten, seiner Keuschheit, seiner Einfalt, Unschuld und Heiligkeit die wunderbarsten Dinge. Unter anderm erzählte er, was Herr Chapelet ihm unter Tränen als seine größte Sünde gebeichtet und wie er ihn kaum zu überzeugen vermocht habe, daß Gott ihm auch diese vergeben werde. Dann begann er die Zuhörer zu schelten und sagte: »Ihr aber, ihr von Gott Verdammten, ihr lästert um jedes Strohhalmes willen, der euch zwischen die Füße kommt, Gott, seine Mutter und alle Heiligen im Paradiese.« Außerdem sagte er noch viel von seiner Herzensgüte und Lauterkeit.
Mit einem Wort, seine Reden, denen die Gemeinde vollkommenen Glauben schenkte, bemächtigten sich in solchem Maße der frommen Herzen der Versammlung, daß alle, sobald der Gottesdienst zu Ende war, sich untereinander stießen und drängten, um dem Toten Hände und Füße zu küssen. Die Kleider wurden ihm auf dem Leibe zerrissen; denn jeder hielt sich für glücklich, wenn er einen Fetzen davon haben konnte. In der Tat mußten die Mönche den Körper den ganzen Tag über ausstellen, daß ihn jedweder nach Gefallen beschauen konnte. In der folgenden Nacht wurde er in einer Kapelle ehrenvoll in einem Marmorsarge bestattet, und schon am Tage darauf fingen die Leute an, den Toten zu besuchen, zu verehren und Lichter anzuzünden. Mit der Zeit gelobten sie ihm Opfergaben und begannen dann, ihrem Versprechen gemäß, Wachsbilder aufzuhängen. Der Ruf seiner Heiligkeit und seine Verehrung wuchsen so sehr, daß nicht leicht jemand in irgendeiner Gefahr einen anderen Heiligen anrief als Sankt Chapelet, wie sie ihn nannten und noch heute nennen, und allgemein wird versichert, daß Gott durch ihn gar viele Wunder getan habe und deren noch täglich an jedem tue, der die Fürsprache dieses Heiligen andächtig erbitte.
So lebte und starb Herr Ciapperello von Prato und wurde ein Heiliger, wie ihr gehört habt. Daß es möglich ist, dieser Mensch sei wirklich im Anschauen Gottes selig, will ich allerdings nicht leugnen, denn so ruchlos und abscheulich sein Leben war, so kann er doch in den letzten Augenblicken seines Lebens so viel Reue empfunden haben, daß Gott sich vielleicht seiner erbarmt und ihn in sein Reich aufgenommen hat. Weil uns dies aber verborgen bleibt, so spreche ich nach dem, was uns offenbar ist, und sage, daß er vielmehr in den Krallen des Teufels verdammt als im Paradiese zu sein verdient. Verhält es sich aber so, dann können wir deutlich erkennen, wie unermeßlich Gottes Gnade gegen uns ist, die nicht unseren Irrtum, sondern die Lauterkeit unseres Glaubens betrachtet, wenn wir einen seiner Feinde in der Meinung, er sei sein Freund, zum Mittler zwischen ihm und uns machen und er uns erhört, als hätten wir uns einen wahren Heiligen zu unserem Fürsprecher bei seiner Gnade erwählt. Und so empfehlen wir uns ihm denn mit allem, was uns not ist, in der festen Überzeugung, erhört zu werden, damit er uns in diesem allgemeinen Elend und in dieser so heiteren Gesellschaft im Lobe seines Namens, in dem wir sie begonnen, gesund und unversehrt erhalten möge. Und damit schwieg Panfilo.