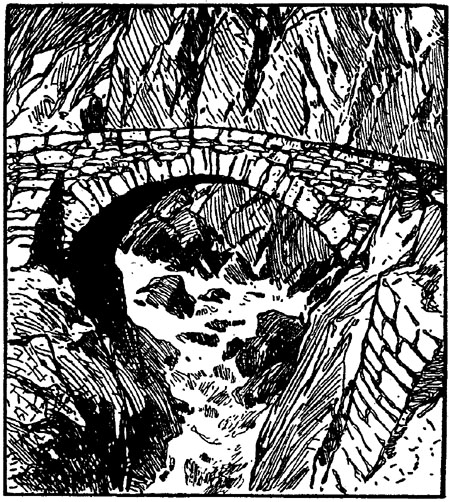Es saß auf Hohenburg ein stolzer Graf, Herr Attich geheißen, dessen Frau gebar ihm ein Mägdlein, und das war blind. Darob ergrimmte Herr Attich und schrie: »Ein blindes Kind will ich nicht; fort mit dem Wurme, und schlagt ihm den Schädel an einem Felsen ein!« und tobte fort. Die Mutter aber sandte alsbald die Amme in Begleitung treuer Knechte mit dem blinden Kinde weit, weit von dannen, gen Palma, das liegt jenseits der Alpenberge in Friaul; dort war ein Frauenmünster, und dorthin ward Herrn Attichs Töchterlein gebracht.
Im Bayerlande aber war ein Bischof mit Namen Erhardus, der hörte im Traume eine Stimme: »Mache dich auf gen Palma in das Stift; dort findest du ein blindes Mägdelein, das sollst du taufen und Ottilia heißen!« Erhardus folgte ohne Weilen der Stimme des Herrn, so er im Traume vernommen, zog gen Palma in das Stift und fand das Kind und taufte es und segnete es. Und siehe, da gingen über der Taufe dem Kinde die Augen auf, und es ward sehend. Und Ottilia blieb im Frauenmünster zu Palma, erwuchs darinnen züchtiglich, erlernte die Orgel schön zu spielen, der Blumen zu pflegen und ihrer Pflichten treulich zu warten.
Herr Attich aber ward vom Himmel heimgesucht, daß er Reue und Leid fühlte ob seines von ihm verstoßenen Kindes, und es trieb ihn zu einer Pilgerfahrt nach Welschland, sein Kind zu suchen. Und da er der Tochter Aufenthalt erfahren, zog er des rechten Weges und hörte nun in Andacht das Wunder, das sich mit ihr begeben, und führte sie zurück nach Hohenburg und an das Herz ihrer Mutter.
Glanz und Reichtum umgab das holde, fromme Kind; aber das alles lockte sie nicht. Und auch als der Ruf ihrer Schönheit und Lieblichkeit sich in der Gegend verbreitete und Freier angezogen kamen, die gern um ihre Hand werben mochten, zeigte sie sich allen abgewendet und wollte allein des Heilands Braut sein. Da nun unter diesen Freiern ein reicher Graf des Gaues war, so gelobte Herr Attich ihm sein Kind zum Ehegenoß und gebot Ottilien, sich nicht länger zu weigern. Das erschreckte die fromme Jungfrau gar sehr. Sie suchte Trost und Rettung im Gebet und fand endlich keinen andern Ratschluß, als schnelle Flucht.
Da nun der Bräutigam am Morgen angeritten kam, war die Braut abhanden und nirgend zu finden. Boten ritten und liefen wohl im Vogesengebirge umher und auf und ab all um den Rhein, und keiner fand Herrn Attichs Tochter, bis nach dreien Tagen endlich die Kunde kam, Ottilia sei in einem Schifflein über den Rhein gefahren, mutterseelenallein, und mochte wohl ein Engel ihr Ferge gewesen sein. Da forschten nun ihr Vater und der Graf gar fleißig nach ihr und waren weit aus und kamen bis gen Freiburg im Breisgau. Und als sie dort im Tale ritten, sahen sie auf einmal auf einer Bergeshöhe die Jungfrau wandeln, und sie sprengten eilend hinan.
Wie nun Ottilia ihre ihr schon nahen Verfolger erkannte, erschrak sie heftig, und sie rief den Himmel um seinen Schutz an. Und da sie an eine Felswand kam, die ihre Schritte gänzlich hemmte, da tat vor ihr die Wand sich auf und schloß sich wieder hinter ihr zu. Aus dem Felsen aber rieselte alsbald ein klarer Wasserquell, und die Verfolger standen davor und wußten nicht, wie ihnen geschehen war.
Nun begann Herr Attich aufs neue in sich zu gehen, seufzte nach der Tochter, blieb an der Quelle und rief dem starren Fels das Gelübde zu, wenn Ottilia wieder zu ihm komme, so wolle er an diesen Ort eine Kapelle bauen und aus seiner Burg ein Kloster machen und das mit reichem Gut begaben. Solches alles geschah, und der Brunnen aus dem Fels ward der Ottilienbrunnen geheißen und übte wundersame Kraft an kranken Augen. Ottilia aber wurde Äbtissin des neuen Klosters, pflegte und heilte Kranke, ward ein Schutzengel des ganzen Gaues und ließ an den Bergesfuß noch ein Kloster, Niedermünster, bauen. Und als sie endlich sanft und selig verschieden, ist sie heilig gesprochen worden, und sie ward die Patronin der Augen und von Augenleidenden insonderheit angerufen.