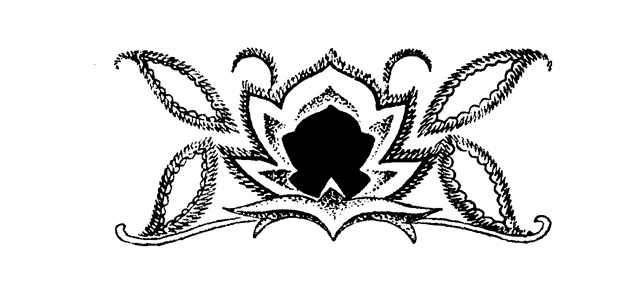Sudabeh saß tief verschleiert auf der Höhe ihres Thrones. Um sie standen an die hundert Mädchen verschiedenen Alters, angefangen vom Kind bis zur reifen Jungfrau. Der Duft der Jugend, Anmut und Lieblichkeit erfüllte den weiten Saal mit dem Atem des Paradieses.
Gleich an der Pforte verneigte sich Sijawusch vor seiner Königin.
Auf einen Wink Sudabehs stiegen die Töne eines Lautenspieles auf, und ein Reigen führte die Schönen an Sijawusch vorüber. Mit Segenswünschen wurde er begrüßt und hundert Herzen schlugen rascher bei dem Anblick des schönen Fürsten. Als sich hinter dem letzten Mädchen der Vorhang schloß, sprang Sudabeh jäh vom Throne auf und warf sich Sijawusch in die Arme.

»Oh, keiner von diesen galt deine Lust!« rief sie zitternd vor Erregung und ließ die Schleier von ihrem Antlitz fallen. »Was sollen dir die Sterne, wenn dir der goldene Mond lacht! Schwöre mir zu, daß ich, sobald dein Vater gestorben ist, die erste im Frauenhaus bleiben soll, dann will ich dir den Himmel erschließen.«
Sijawusch glühte unter den begehrenden Küssen dieser schönen Frau. »O schweige, schweige – du sollst geliebt und geehrt werden, aber als meine Mutter! Gib mir deine junge Tochter zur Braut. Ich will ihr die Treue halten, bis sie zum Weibe herangereift ist!«
»Sijawusch!« – wie die Androhung eines Fluches rief diesen Namen Sudabeh. Zitternd wandte sich der Angerufene ab und verließ, fast flüchtend, das Frauenhaus. Sudabeh sank in die Knie und eine Ohnmacht ließ sie niederfallen. Als Kawus ins Frauenhaus kam, empfing Sudabeh ihren Gatten mit stolzer Würde.
»Dein edler Sohn ließ alle an sich vorbeigehen. Nur meinem Töchterlein hat sich sein Herz erschlossen und er will warten, bis sie zum Weibe herangereift ist.«
Diese Nachricht erfreute den Schah, er ließ reiche Schätze im Frauenhaus abladen, damit seine Gattin Sudabeh die Tochter würdig beschenken könne, wenn diese Sijawusch heirate.
Kaum hatte sich Kawus von der Königin verabschiedet, so ward auch gleich von dieser Hirbad zu Sijawusch gesandt. Sie ließ den Prinzen im Namen des Herrschers nach dem Frauenhaus rufen. Sijawusch kam und wurde von dem Kämmerer in ein hell erleuchtetes Gemach geführt. Bis an die Decke lagen da Kostbarkeiten gehäuft, Gold, Edelgestein, Perlen, Geschmeide. Wie geblendet stand Sijawusch vor dem Schatz. Da öffnete sich lautlos ein Vorhang, und als Sijawusch aufblickte, stand Sudabeh in Atemnähe neben ihm.
»Sijawusch,« sprach sie ihm ganz leise ins Ohr, »der Schatz gehört dir, aber noch mehr, oh, vieles, vieles mehr – wenn du dich mir gibst, wie ich mich dir geben will!«
Schaudernd beugte sich Sijawusch zurück. Sie aber folgte dieser Bewegung nach. »Sprich doch, sprich doch, weiche mir nicht aus.« Und nun flehte sie, ganz ihrer Glut verfallen. »Erbarme dich meiner jungen Liebe zu dir. Oh, ich kann es dir nicht verbergen. Nimm mich, hilf mir!«
Sijawusch bedeckte sein Antlitz mit den Händen und floh aus dem Gemach. Totenbleich sank Sudabeh neben dem Schatz zu Boden. Und als sie erwachte, gab sie sich der Wollust des Schmerzes hin, zerfetzte ihre Kleider, und in die nun aufschimmernden Blößen schlug sie besinnungslos mit ihren Nägeln. Da huschte Hirbad herein. »Der König kommt!« flüsterte er und verschwand, dem Schatz ausweichend, hinter einem anderen Vorhang.
Sudabeh richtete sich auf. »Rache!« sprach sie, und, ganz ihre Haltung gewinnend, rief sie: »Wohin du auch fliehst, du fliehst in dein Verderben, Sijawusch!«
Als Kai Kawus das Gemach betrat, wankte die Königin ihm entgegen und klagte an: »Sieh mich an, dies, dies hat dein stolzer Sohn an mir getan. Die blutige Spur, die über meine Brüste läuft, die riß dein Sohn, als er gierig nach mir griff. Dies Kleid riß er in Fetzen, um meinen nackten Körper fühlen zu können. Mein Diadem fiel zu Boden. Er tat dies, er, der alle Mädchen an sich vorbeigehen ließ, weil er in seinem Wahnwitz die Mutter begehrt, mich! Oh, ich bin entehrt – räche mich, du, mein Gemahl und Herr!«
Gefaßt stand Kawus, er konnte, trotz dieser anklagenden Worte, den Mut seines adeligen Sohnes nicht vergessen, und er gebot sich Vorsicht. Die Listen der Frauen sind tückisch. Er ließ Sijawusch rufen.
»Gestehe!« sprach er ernst den Eintretenden an, »du hast Sudabeh überfallen, doch liegt die Schuld an mir – ich sandte dich ins Frauenhaus.«
»Du irrst! Ich ließ die Königin unberührt.«
»Er lügt! Als ich ihm den Brautschatz zeigte, da riß er mich in seine starken Arme, immer kräftiger schlang er sie um mich, ich meinte zu ersticken. So, in meiner hilflosen Haltung, überfiel er mich mit Küssen. Und je mehr ich mich wehrte, desto heftiger wurde er, zerrte an meinem Kleide und wühlte mit bösen Fingern in meinem Haar.«
»Genug!« rief der König. »Reich mir deine Hand, Sijawusch! Sie duftet nicht nach Amber und nach Rosen. Du hast gelogen, Sudabeh!« Der König schritt mit seinem Sohne an der Hand bis an die Pforte.
»Bleib!« schrie die Königin auf, »wisse, sein Überfall gelang ihm, er hat mich geschändet. Nun wird er mich töten, wie er das Kind getötet hat, das ich von dir, o König, am Herzen trage.«
Der König blieb gebannt an der Schwelle stehen. »Räche mich, vernichte den Frevler!«
Rasch verließ der König das Frauenhaus und zog den Sohn mit sich.
»Verloren! Um Liebe und Rache gebracht von einem kalten Jüngling und einem liebenden Greis. Ich werde sie beide zu betrügen wissen. Der Zauber soll mir seifen. Nicht die guten, nur die bösen Geister.«
Vor kurzem war eine Landfahrerin von Sudabeh als Dienerin in den Palast aufgenommen worden. Gerührt von der Geschichte ihres Elends, hatte die Königin die Bettelnde beschenkt. Sie sei aus vornehmem Geschlecht und der Verführung eines Treulosen erlegen. Nun schleppe sie die Schande mit sich, und es seien nur noch Wochen, dann werde diese auch offenbar werden.
Sudabeh ging zu der Landfahrerin, nahm sie in ihr Schlafzimmer und verschloß hinter ihr den Eingang.
»Schwöre mir zu, daß du ein Geheimnis bewahrst, was immer auch kommen mag. Tust du es, so will ich deinen Ruf behüten und dich auch reich beschenken.«
»Oh, wenn du dies imstande bist! Keine Gewalt ist so groß, als daß sie mir das Geheimnis entreißen könnte.«
»Du mußt es beschwören! Schwöre!« Als die Klagende dies tat, raffte die Königin Gold und Geschmeide zusammen und ließ es in deren Schürze fallen. Keinen Augenblick zögerte die Königin nun, ihren Plan auszuführen. Die Dienerin bekam von Sudabeh ein giftiges Tränklein und durfte nicht aus dem Schlafgemach. Als der Morgen kam, gebar die Dienerin in dem Bett der Königin zwei tote Wechselbälge. Als die erschöpfte Mutter in ein Nebengemach geführt war, begann die Königin ihr Wehgeschrei. Auf einer silbernen Schüssel lagen schon vorbereitet die beiden Leichen. Die Bewohner des Frauenhauses liefen auf das Geschrei zusammen. »Seht her, das hab‘ ich zur Welt gebracht!«

Das Geschrei der Frauen erscholl im ganzen Umkreis des Palastes. Auch der König vernahm es und eilte in den Frauenpalast.
»Blick‘ her und versuche noch zu zweifeln!« schrie ihm die Königin entgegen. »Sieh‘, was der Schrecken des Überfalls aus deinen Kindern gemacht hat. Die Teufelsbrut mit den Zeichen der Hölle – hier liegen sie, verendet!« Bei diesen Worten hielt sie die Schüssel, wie vom Ekel geschüttelt, weit von sich, schrie und weinte dabei.
Entsetzt wich der König zurück. Sollte er an seinem Sohne zweifeln!
Der König eilte in den Palast zurück und gebot die Weisen seines Reiches zu sich. Ihnen bekannte er die Ratlosigkeit seines Herzens, das beiden, seinem edlen Sohne und seiner Gattin, ergeben sei. Wen von beiden müsse er verdammen?
Die Priester sammelten sich, ihr Opfer zu besehen; die Magier suchten in den ältesten Büchern; die Sterndeuter forschten am nächtlichen Himmel: alle waren so redlich bemüht, dem König mit göttlichem Rat beizustehen. Nach zwei Wochen kamen die Weisen, um ihr Ergebnis zu künden. Die Sterndeuter sagten aus, daß die toten Kinder weder vom König, noch von seiner Gattin stammen konnten, denn die Gestirne sagten nichts aus von einer Vermehrung des Kajanidengeschlechtes. Die Magier wieder fanden Spuren, die auf einen Gifttrank hinwiesen, die Priester Zeichen, die auf eine Fremde deuteten, welche die Mutter dieser zwei Ausgeburten wäre.
Der König handelte nach diesen Weisungen. Das Frauenhaus wurde durchsucht und die Landstreicherin vor den Thron gebracht. Doch, wie man es auch anstellte, ein Geständnis war aus dem Weibe nicht herauszuholen. Auch der glühenden Zange des Henkers widerstand sie.
Sudabeh nannte die Weisen Feiglinge, die Sijawusch und seinen unüberwindlichen Beschützer Rustan fürchten. Täglich weinte sie ihrem Gatten vor, die Entehrung und den Schmerz einer geschändeten Mutter, welche zwei tote Kinder gebar. Sie bestand auf strengem Gericht oder – Gottesurteil. Die tückische Schöne wußte, daß die schwere Probe nicht der Kläger, sondern der Angeklagte zu bestehen hat.
Das Leiden seines geliebten Weibes machte den König wieder unsicher. Neuerlich wurden die Weisen zum Rat versammelt und um die endgültige Probe befragt. Die Alten nannten die Feuerprobe als einzigen Weg.
Sijawusch willigte ein, diesen Weg zu gehen.
Vor dem Stadttore wurden zwei mächtige Holzstöße aufgerichtet. Zwischen ihnen wurde nur so viel Platz gelassen, daß ein Reiter hindurch konnte. Am Tage des Gerichts sammelten sich um die Opferstätte die Großen des Reiches und das Volk stand im weiten Bogen um die beider Scheiterhaufen. Bei dem Stand der Sonne im Mittag wurden die Stöße von dem Oberpriester mit einem Span aus dem heiligen Feuer entzündet. Rasch gossen zweihundert Knechte Öl auf das Holz und fachten die Glut zu loderndem Feuer an. Es qualmten dunkle Wolken gegen den Himmel und bald stiegen auch haushohe Flammen empor.
Die schwarzen Locken von einem goldenen Helm bedeckt, in einem wehenden schneeweißen Mantel kam Sijawusch auf seinem Streitroß. Feierlich und mit offenem Blick begrüßte er den König und die um ihn versammelten Weisen. Kawus bangte um das Leben seines edlen Sohnes. »Ach,« rief er vom Schmerz gepeinigt, »das schlimmste Getier bringt nicht so viel Leid in die Welt, als es ein schönes Weib vermag!«
»Bange nicht, Vater!« rief Sijawusch, »der Herr ist gerecht!« Dann riß er sein Pferd um und hielt knapp vor dem Eingang der brennenden Gasse. Dort hob er die Hände gegen die Flamme und sprach das Gebet vor der Feuerprobe. Als er dieses beendet hatte, gab er seinem Pferde die Sporen und verschwand in den lodernden Flammen.
Sudabeh beobachtete vom Dach ihres Hauses aus das Schauspiel des Feuers. »Er reitet in den Tod und ich bin gerächt!« schrie sie triumphierend. Als die Menge noch kreischte und wehklagte, durchschnitten einzelne helle Jubelrufe die dunkle Wolke des Geschreis und versanken endlich in einem allgemeinen Jubel. Sijawusch hatte das Feuer durchritten. Das Element des Feuers war gerechter als eine Frau. Hätte er durch blühende Blumen reiten müssen, so hätte Tau ihn benetzt, aber das läuternde Feuer ließ den Reinen unberührt. Der Prinz sprang aus dem Sattel und küßte vor seinem Vater die Erde. Beglückt hieß ihn der König aufstehen und schloß ihn in seine Arme. Festliche Scharen wallfahrten zum Palast, wo Mahl, Gelage und Scherz den Tag beendeten, der die Unschuld des Prinzen vor Gott und der Welt erwiesen hatte.
Nachdem das Fest verklungen war, ließ der König seine Gattin vor sein Angesicht rufen.
»Du konntest nur lügen, erkenne deine schamlose Verwegenheit! Bereust du es nicht, den Reinen bis an die Pforte des Todes gelockt zu haben?«
»Wie konnte er sterben?!« höhnte grell lachend Sudabeh. »Der Schützling Rustans ist zauberkundig genug, um vor dem Feuer nicht zu bangen! Der Böse ist schützend über den Seinen!«
»Elende!« schrie der König voll Zorn, »soll dich der Henker ergreifen, dich, deren Haß auch die göttliche Flamme nicht anerkennt?«
»Tod, Tod, ihr, die den Reinen noch zu beflecken wagt!« Die aufgebrachte Menge schrie es und drängte den Henker zum Throne hin. Der König winkte jetzt dem Henker und befahl ihm: »Wende ihr Antlitz im Genick und hänge sie am Ende der Gasse auf. Sie sei so eine Warnung für alle Frevler, die lügen!«
Ehe noch der Henker nach der Königin griff, gebot Sijawusch halt. »Vater, schenke mir das Leben der Verblendeten!«
»Alles, so du es wünschest!« antwortete der König erfreut.
Sudabeh war vor der Hand des Henkers zurückgebebt, nun stützte sie sich zitternd auf den Arm des Prinzen, der sie bis zum Tore des Frauenhauses geleitete.
Kai Kawus‘ Herz schlug freudig, denn dieser Tag schenkte ihm wieder Sohn und Gattin.