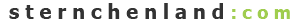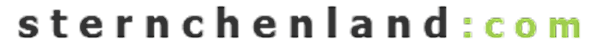Zeichop
Operative-logisches Zeichen
Als operativ-logisches Zeichen bezeichnet man Zeichen, die Prozesse zum Erhalten von Termini und Aussagen aus anderen Termini und Aussagen bezeichen. Beispiel: Wir nehmen an, Gegeben sei …Zeitgei
Zeitgeist, genius saeculi, Geist der Zeiten
Als Zeitgeist bezeichnet man die Besonderheiten des Denkens und Empfindens, der Ideale und Werte in einer bestimmten geschichtlichen Periode. Der Begriff kam im 18. Jahrhundert auf. Man verwendete im 18. und 19. Jahrhundert auch die Synonyme genius saeculi, Geist der Zeit und Geist der Zeiten.
Zeitlog
Zeitlogik
Als Zeitlogik bezeichnet man jenen Zweig der Logik, der Kalküle studiert, in denen Phänomene der Zeit berücksichtigt werden können. So werden Termini wie früher, später, gleichzeitig untersucht.Ein Beispiel ist die Zeitlogik von Prior.
Seit den 1950er Jahren wurden von zahlreichen Kalkülen zunächst syntaktische Zeitkalküle entwickelt. Später folgte auch die Untersuchung geeigneter Semantiken.
Die Zeitlogik spielt insbesondere in den Computerwissenschaften eine große Rolle.
Zenparad
Zenonsche Paradoxien
Als Zenonsche Paradoxien bezeichnet man Paradoxien, die Zenon von Elea verwendete, um die Lehre von Parmenides zu stützen. Sie sollen die Realität von Vielheit und Bewegung widerlegen, indem sie aus der Annahme, dass Vielheit und Bewegung real seien, paradoxe Konsequenzen ableiten. Zenon verwendet diese Paradoxien also als Grundlage indirekter Beweise.Zu den Zenonschen Paradoxien zählen das Dichotomieparadoxon, das Paradoxon von Achilleus und der Schildkröte, das Paradoxon vom fliegenden Pfeil und das Paradoxon von den Reihen in Bewegung.
X
x
x ist das mathematische Zeichen für unbekannte Größen. Es entstand aus dem in Ligatur geschriebenen cs = cosa (ital. Ursache).Xenokrat
Xenokratie
Als Xenokratie bezeichnet man die Fremdherrschaft.Xyz
XYZ
Als XYZ bezeichnet man die Substanz auf der Zwillingserde (twin earth), die wie H2O (d. h. Wasser) aus der Erde aussieht und sich auch so verhält.Yoga
Yoga
Yoga (sanskrit: Anschauung, Einspannung, Vereinigung) nennt man in der indischen Philosophie ein Theorie oder Praxis der Konzentration und Meditation, um die höchste Einsicht und die Erlösung zu erreichen.Der Zweck der Anspannung ist es, sich von dem störenden Einfluß der Außenwelt zu befreien.
Seit der vedischen Zeit sind verschiedene Systeme und Methoden des Yoga bei Buddhisten, Jainas und Brahamanen entwickelt worden.
Wissen
Wissen
Als Wissen bezeichnet man den Erkenntniszustand allgemeiner intersubjektiv-vermittelter Sicherheit.Wissen wird von Erfahrung, Erkenntnis, Gewißheit, Empfinden, Meinen und Glauben abgegrenzt.
Wir unterscheiden zumindest drei Formen des Wissens: Wissen-Daß, Wissen-Von und Wissen-Wie.